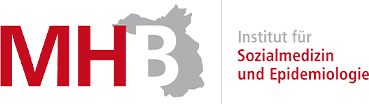PatientInnen
Die Studie mit dem Titel “Patients’ perspectives on digital health tools” (2023) untersucht, welche Faktoren aus Sicht von Patientinnen und Patienten die Nutzung digitaler Gesundheitsanwendungen erleichtern oder behindern. Ziel der Arbeit war es, vorhandene wissenschaftliche Literatur systematisch zu analysieren, um ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse, Erwartungen und Hürden von Patient:innen im Umgang mit digitalen Gesundheitstools zu gewinnen. Die Analyse von 71 relevanten Studien ergab dabei, dass Patient Empowerment, Selbstmanagement und Personalisierung als zentrale fördernde Faktoren gelten, während geringe digitale und gesundheitliche Kompetenzen sowie Datenschutzbedenken als zentrale Hürden identifiziert wurden. Die Autor:innen betonen die Bedeutung partizipativer Designansätze, um digitale Gesundheitslösungen stärker an den tatsächlichen Bedürfnissen von Patient:innen auszurichten. (Madanian u. a. 2023)
Der Digital-Kompass fördert digitale Teilhabe und unterstützt Menschen dabei, digitale Barrieren zu überwinden. Mit Angeboten wie Lern-Tandems, Qualifizierungen und Materialien wie der Anleitung „Gesundheits-Apps mit Exkurs E-Rezept“ richtet sich das Projekt an alle, insbesondere an ältere Menschen und Personen mit Einschränkungen. Veranstaltungen wie Online-Seminare zu Datenschutz, digitaler Barrierefreiheit oder individuellen Gesundheitsleistungen sowie der Digital-Kompass Podcast bieten Wissen und Austausch. Das Projekt setzt sich für barrierefreien Zugang und gesellschaftliche Teilhabe ein und wird von BAGSO, Deutschland sicher im Netz e.V. und dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz unterstützt.
PatientInnengenerierte Gesundheitsdaten (PGHD)
Die Studie „Consumer Data is Key to Artificial Intelligence Value: Welcome to the Health Care Future“ zeigt, dass der größte Nutzen von Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen nur dann erreicht werden kann, wenn Patientinnen und Patienten ihre Gesundheitsdaten selbst verwalten und aggregieren. Durch technische Standards wie FHIR, gesetzliche Vorgaben der 21st Century Cures Act und die wachsende Bedeutung patienteneigener Daten – insbesondere in seltenen Erkrankungen – entsteht ein neues Modell, bei dem der Mensch als zentraler Verwalter seiner „Longitudinal Health Records“ agiert. Die Studie betont, dass KI-basierte Analysen und eine verbesserte medizinische Versorgung nur möglich sind, wenn umfassende, vollständige und aktuelle Gesundheitsdaten direkt von den Patienten bereitgestellt werden. (C 2025)
Digitale Hilfsangebote
Patientenverfügung
Der Malteser Online-Assistent Patientenverfügung ist ein webbasiertes Hilfsangebot zur Erstellung einer individuellen Patientenverfügung. Nutzerinnen und Nutzer werden Schritt für Schritt durch die Inhalte geführt und erhalten begleitende Erläuterungen zu medizinischen, ethischen und rechtlichen Fragestellungen. Textbausteine, Videos und Freitextfelder unterstützen bei der Formulierung eigener Wünsche. Nach Abschluss kann die Patientenverfügung ausgedruckt und unterschrieben werden.
Organspende
Das digitale Organspende-Register in Deutschland ermöglicht es Bürgerinnen und Bürgern ab 16 Jahren, ihre Entscheidung zur Organ- und Gewebespende rechtlich verbindlich und kostenfrei online zu dokumentieren. Die Registrierung erfolgt über die Webseite organspende-register.de unter Nutzung der Online-Ausweisfunktion des Personalausweises (eID) zur sicheren Identifikation. Nach Eingabe der persönlichen Daten kann die Entscheidung für oder gegen eine Spende abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Das Register wird vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) betrieben und stellt sicher, dass die Erklärung im Ernstfall für berechtigte medizinische Einrichtungen abrufbar ist.
Rente
RentenNavi ist ein KI-basierter Agent, der angehende Rentner bei der Erstellung von Rentenanträgen unterstützt. Über Messenger-Dienste werden Text-, Sprach- und Bildinformationen erfasst und in den Antrag integriert, wobei die Interaktion in leichter Sprache und im individuellen Stil des Nutzers erfolgt. Das Startup existiert seit 2023 und wird als skalierbare Lösung für weitere Rententhemen aufgebaut, mit Fokus auf den deutschen Markt.
Digitale Gesundheitsaufklärung
Plattformen wie washabich.de und gesund.bund.de bieten verlässliche Gesundheitsinformationen für Patientinnen. Sie bieten Gesundheitsinformationen in einer leicht verständlichen Form, die es Patientinnen ermöglicht, komplexe medizinische Konzepte zu begreifen, ohne dass sie Fachwissen voraussetzen.
| Product | Company | URL |
|---|---|---|
| Was hab ich | Was hab’ ich? gemeinnützige GmbH | washabich.de |
| Gesund.bund.de | Bundesministerium für Gesundheit | gesund.bund.de |
| Simply Onno | Simply Onno | simply-onno.com |
Es gibt Nachweise, die die Wirksamkeit von TheraKey hervorheben. Es ist ein digitales Therapiebegleitprogramm, das Patient:innen mit chronischen Erkrankungen bei der Aufklärung, dem Selbstmanagement und der Therapietreue unterstützt. Evaluationen zeigen, dass 78 % der Nutzer:innen nach dem Einsatz des Onlineportals besser mit ihrer Erkrankung umgehen können. In einer Studie mit 185 Menschen zeigte nach drei Monaten Verbesserungen bei Selbstmanagement, Wohlbefinden, Adhärenz und einer Reduktion krankheitsbezogener Belastung. 84 % der Befragten vertrauten den TheraKey-Inhalten mehr als anderen Onlinequellen. (Kulzer u. a. 2022; Red 2017, 2013)
Die Studie „AI-generated patient-friendly discharge summaries to empower patients“ untersucht, ob durch KI erstellte, patientenfreundliche Entlassungszusammenfassungen das Verständnis von Patienten für ihre Erkrankung verbessern können. In einer Untersuchung mit 20 Patientinnen und Patienten in einem Tertiärkrankenhaus berichteten 90% von einem besseren Verständnis nach dem Lesen der KI-generierten Zusammenfassung. Besonders ältere Patienten zeigten großes Interesse an solchen Zusammenfassungen für zukünftige Krankenhausaufenthalte. Die Ergebnisse zeigen, dass KI-gestützte Texte die Patientenkommunikation deutlich verbessern können, wenngleich weitere große Studien zur Absicherung der Ergebnisse nötig sind. (Reuter u. a. 2025)
DocToRead ist eine kostenpflichtige App, die medizinische Dokumente in leicht verständliche Alltagssprache übersetzt. Sie hilft Nutzern dabei, medizinische Befunde, Arztbriefe oder Laborberichte schnell und sicher zu verstehen.
Die DTB Gesellschaft für digitale Therapiebegleitung mbH bietet mit dem Tino DTB ein digitales Medizinprodukt zur Unterstützung von Krebspatienten in der Tumortherapie. Die App ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Patienten und Praxisteam, indem sie Medikationspläne, Einnahmeerinnerungen und qualitätsgesicherte Therapieinformationen bereitstellt. Patienten können ihren Gesundheitszustand und Vitalwerte dokumentieren, während Ärzte in Echtzeit den Therapieverlauf überwachen und Korrelationen zwischen Einnahme, Nebenwirkungen und Vitalwerten analysieren können. Der Tino DTB, der als „App auf Rezept“ verordnet werden kann.
Die Studie mit dem Titel „Understanding how digital health literacy affects health self-management behaviors: The mediating role of self-efficacy in college students“ untersucht den Einfluss der digitalen Gesundheitskompetenz auf das Gesundheits-Selbstmanagement von Studierenden. Dabei wird insbesondere geprüft, inwiefern das Selbstwirksamkeitserleben eine vermittelnde Rolle zwischen digitaler Gesundheitskompetenz und gesundheitsförderlichem Verhalten spielt. In einer Querschnittsstudie wurden 741 Studierende aus fünf chinesischen Universitäten befragt und mit validierten Skalen zu digitaler Gesundheitskompetenz, Selbstwirksamkeit und Gesundheits-Selbstmanagement untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl digitale Gesundheitskompetenz als auch Selbstwirksamkeit signifikant positiv mit gesundheitsbezogenem Selbstmanagement korrelieren und dass Selbstwirksamkeit den Zusammenhang teilweise vermittelt. Die Studie betont die Bedeutung gezielter Bildungsmaßnahmen, die digitale Kompetenzen sowie Selbstvertrauen stärken, um das Gesundheitsverhalten junger Erwachsener nachhaltig zu verbessern. (Zhou u. a. 2025)
Die Studie mit dem Titel „Developing an online health literacy curriculum for two German universities: a key stakeholder approach“ beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Online-Kurses zur Gesundheitskompetenz für Studierende an zwei deutschen Universitäten. Ziel der Studie war es, den Bedarf an einem solchen Einsteigerkurs zu ermitteln und dabei die Bedürfnisse der Studierenden sowie das Feedback von internationalen Experten aus den Bereichen Bildung und Gesundheitskompetenz zu berücksichtigen. Dafür wurden Fokusgruppengespräche mit Studierenden sowie eine Online-Bewertung des Kursentwurfs durch internationale Stakeholder durchgeführt. Aufbauend auf einem bestehenden kanadischen Online-Kurs wurde das Curriculum für den deutschen Kontext angepasst und maßgeschneidert, um Inhalte, Design und Umsetzung eines für Universitäten in Deutschland geeigneten Kurses zu gestalten. Die Ergebnisse zeigen breite Unterstützung für die Entwicklung dieses Online-Gesundheitskompetenzkurses. (Vamos u. a. 2018)
Die Studie mit dem Titel „New technologies, new disparities: The intersection of electronic health and digital health literacy“ von Benjamin Smith und Jared W. Magnani untersucht den Zusammenhang zwischen neuen digitalen Gesundheitstechnologien, insbesondere im Bereich der mobilen Gesundheitsdienste (mHealth), und den bestehenden Ungleichheiten in der digitalen Gesundheitskompetenz. Die Autoren zeigen auf, dass digitale Gesundheitsangebote vor allem für Bevölkerungsgruppen mit eingeschränkter Gesundheits- und Lesekompetenz zusätzliche Herausforderungen darstellen. Besonders ältere Menschen, sozial benachteiligte Gruppen und Minderheiten sind von begrenztem Zugang und Nutzungsmöglichkeiten betroffen. Im Fokus steht die digitale Gesundheitskompetenz als notwendige Zusatzfähigkeit zur allgemeinen Gesundheitskompetenz, um digitale Angebote effektiv nutzen zu können. Die Studie schlägt eine 18-Punkte-Strategie („Digital Universal Precautions“) vor, mit der Gesundheitseinrichtungen den Zugang zu digitalen Gesundheitsdiensten für alle Patienten verbessern sollen. Damit soll der Problematik entgegengewirkt werden, dass digitale Gesundheitsanwendungen bestehende gesundheitliche Ungleichheiten verstärken könnten. (Smith und Magnani 2019)
Die Studie „Evaluating the impact of easy-to-understand patient letters after discharge on patients’ health literacy: a randomized controlled study“ untersucht, ob leicht verständliche Patientenbriefe die Gesundheitskompetenz von kardiologischen Patienten nach Krankenhausentlassung verbessern. In einer randomisierten kontrollierten Studie mit 738 Patienten eines Herzzentrums in Dresden erhielt die Interventionsgruppe zusätzlich zum üblichen Entlassungsbrief einen automatisch generierten, patientenfreundlichen Brief. Die Ergebnisse zeigen, dass die Interventionsgruppe signifikant höhere Gesundheitskompetenz aufwies und die Briefe als hilfreich, verständlich und informativ wahrnahm. Qualitative Interviews bestätigten eine positive Einstellung, wiesen aber auch auf Verbesserungspotenziale hin. Die Studie legt nahe, dass solche Briefe die Patientenaufklärung verbessern und in die Regelversorgung integriert werden sollten.
Gesundheitskompetenz
Die Studie „Gesundheitskompetenz in Deutschland 2024“ zeigt, dass 75,8% der internetnutzenden Bevölkerung in Deutschland eine niedrige Gesundheitskompetenz aufweist, was eine Verschlechterung gegenüber 54,3% (2014) und 64,2% (2020) darstellt. Besonders schwierig empfinden die Befragten das kritische Beurteilen von Informationen, insbesondere im Bereich der Krankheitsbewältigung. Jüngere Menschen und Personen in den „alten“ Bundesländern weisen ein erhöhtes Risiko für niedrige Gesundheitskompetenz auf. Zudem korreliert eine niedrige Gesundheitskompetenz signifikant mit schlechterem physischen und mentalen Gesundheitszustand. Die Studie betont die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Verbesserung der Verfügbarkeit verständlicher Gesundheitsinformationen und zur Stärkung der Informationskompetenz der Bevölkerung. (Kolpatzik u. a. 2025)
Patientenmeinung
Die Studie „BCN Deutschland-Puls“ (2025) untersucht das Vertrauen der Bevölkerung in Gesundheitssystem, Politik und zentrale Gesundheitsthemen. Besonders hervor tritt die ambivalente Haltung zur Digitalisierung: 88 % kennen die elektronische Patientenakte (ePA), 65 % haben bereits ein E-Rezept genutzt. Während viele Befragte Vorteile in Vereinfachung und Vorsorge sehen, äußern 30 % Datenschutzbedenken zur ePA und 19 % zum E-Rezept. Damit zeigt die Studie, dass digitale Lösungen zwar breite Bekanntheit und Nutzung erfahren, Vertrauen und Akzeptanz jedoch nicht uneingeschränkt vorhanden sind. (Network 2025)
Forschung
ePatient
Die Studie „From Internet to Artificial Intelligence (AI) Bots: Symbiotic Evolutions of Digital Technologies and e-Patients“ untersucht die Entwicklung des e-Patienten, der durch digitale Technologien „ausgestattet, befähigt, ermächtigt und engagiert“ ist. Beginnend mit dem Aufkommen des World Wide Web und Gesundheits-Websites ermöglichten elektronische Patientenakten und Patientenportale den Zugang zu Gesundheitsdaten, während Smartphones und Apps die Eigenverantwortung der Patienten förderten. Telemedizin und soziale Netzwerke verbesserten die Kommunikation und den Austausch zwischen Patienten und Anbietern, besonders während der COVID-19-Pandemie. Künstliche Intelligenz bietet nun neues Potenzial, um Patienten ein besseres Verständnis ihrer Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten zu ermöglichen. Diese symbiotische Entwicklung digitaler Technologien und e-Patienten hat die Gesundheitsversorgung sicherer und patientenorientierter gemacht. (Sands und Finn 2025a)
Die Studie „Meet the e-patient“: Chancen und Risiken des Internets für das Verhältnis von Gesundheitsfachleuten und ihren Klienten von Thomas Berger untersucht die Auswirkungen des Internets auf die Arzt-Patienten-Beziehung. Sie beschreibt, wie Patienten durch Online-Informationen und Plattformen wie „rate your therapist“ aktiv an Diagnose- und Therapieentscheidungen teilnehmen. Die Studie beleuchtet Chancen, wie eine stärkere Patientenbeteiligung, aber auch Risiken, wie die Herausforderung für Fachkräfte, mit informierten „e-Patienten“ umzugehen. Berger analysiert klinische Szenarien und verweist auf die Notwendigkeit, die Dynamik dieser neuen Beziehung anzupassen. (Stetina, Kryspin-Exner, und Berger 2009)
Die Studie „Der E-Patient: Chancen und Risiken des Internets in Medizin und Psychotherapie“ von Christiane Eichenberg untersucht die Möglichkeiten und Herausforderungen der Internetnutzung in der Psychotherapie. Sie beleuchtet, wie Patienten wie Anja, die an sozialer Phobie leidet, online nach Informationen und Hilfsangeboten suchen, etwa Selbsthilfebüchern oder virtuellen Therapieformen. Die Autorin beschreibt die Vielfalt an Online-Ressourcen und die Schwierigkeit, seriöse Angebote zu identifizieren. Gleichzeitig thematisiert sie Herausforderungen für Therapeuten, wie den Umgang mit online-informierten Patienten, Datenschutz und die Integration digitaler Kommunikationsformen in die Behandlung. Der Beitrag skizziert Chancen, Risiken und Implikationen für die therapeutische Beziehung sowie Lösungsansätze für den Einsatz von Online-Technologien. (Eichenberg 2009)
Die Studie „Preparing medical students for the e-patient“ von Ken Masters beschreibt die Notwendigkeit, Medizinstudenten auf die Interaktion mit sogenannten e-Patienten vorzubereiten, die aktiv online nach medizinischen Informationen suchen und diese in ihre Gesundheitsentscheidungen einbeziehen. Der Leitfaden definiert das Konzept des e-Patienten, beleuchtet dessen Geschichte und typische Aktivitäten wie die Nutzung von Online-Ressourcen, sozialen Medien und Gesundheits-Apps. Er diskutiert die Herausforderungen, die durch die oft ungenaue oder missverstandene Information entstehen, und deren Einfluss auf die Arzt-Patient-Beziehung. Abschließend bietet die Studie praktische Empfehlungen für die Integration von Schulungsinhalten in den medizinischen Lehrplan, um zukünftige Ärzte auf die Zusammenarbeit mit informierten und engagierten Patienten vorzubereiten. (Masters 2017)
Die Arbeit „The digital patient: transforming primary care?“ untersucht den Einfluss digitaler Technologien auf die Gesundheitsversorgung im britischen NHS. Sie analysiert verschiedene patientenorientierte Technologien wie Wearables, Online-Triage-Tools, Gesundheitsinformationen, Terminbuchungen, Fernkonsultationen, Zugang zu Patientenakten und Apps. Die Studie zeigt, dass diese Technologien das Potenzial haben, die Selbstverwaltung von Patienten zu verbessern und die Patientenerfahrung zu optimieren, jedoch fehlt es oft an Beweisen für ihre Auswirkungen auf die Nachfrage und Gesundheitsergebnisse. Herausforderungen wie geringe Nutzung, digitale Ausgrenzung und Datenschutzbedenken werden hervorgehoben, während Empfehlungen für eine stärkere Einbindung von Fachkräften, benutzerfreundliches Design und eine systemweite Herangehensweise gegeben werden. Abschließend wird die Notwendigkeit betont, die Evidenzbasis zu stärken und innovative Partnerschaften mit dem privaten Sektor zu fördern, um die NHS-Dienstleistungen effektiv zu transformieren. (Castle-Clarke und Imison 2016)
Die Studie „From Internet to Artificial Intelligence (AI) Bots: Symbiotic Evolutions of Digital Technologies and e-Patients“, veröffentlicht 2025 im Journal of Participatory Medicine, untersucht die parallele Entwicklung digitaler Technologien und des sogenannten E-Patients – eines Patienten, der informiert, befähigt, engagiert und beteiligt ist. Sie beschreibt, wie das Internet, elektronische Patientenakten, mobile Geräte, Telemedizin und künstliche Intelligenz die Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten im Gesundheitswesen erweitert haben. Der Artikel zeigt, dass diese technologischen Fortschritte zu einer stärkeren Einbindung von Patienten in ihre Versorgung geführt haben, und diskutiert zugleich Herausforderungen wie Datenschutz, Sicherheit, Gerechtigkeit und Kosten. (Sands und Finn 2025b)
Das White Paper mit dem Titel Mit KI zur gemeinsamen Entscheidungsfindung in der Medizin: Ein praktischer Wegweiser befasst sich damit, wie Künstliche Intelligenz (KI) Patient:innen dazu befähigen kann, eine aktivere Rolle in Therapieentscheidungen zu spielen und das Shared Decision Making (SDM) zu verbessern. Es beleuchtet sowohl die Chancen als auch die Herausforderungen der KI-Integration in die Medizin und dient als umfassende Diskussionsgrundlage für Patient:innen, medizinisches Fachpersonal sowie Vertreter:innen aus Politik und Wirtschaft. Ziel ist es, praktische Tipps für den Einsatz von KI-Tools zu geben, um Patient:innen eine bessere Vorbereitung auf Arztgespräche und fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. („White Paper - KI und Shared Decision Making“ o. J.)
Die Studie “Opinion leader empowered patients about the era of digital health: a qualitative study” untersucht, wie israelische Ärzte aus vier Fachrichtungen mit internetinformierten E-Patienten umgehen und ihre neuen beruflichen Rollen reflektieren. Durch 32 Tiefeninterviews zeigt sie, dass die Grenzen zwischen ärztlichem und patienteneigenem Wissen, ärztlicher Autorität und Patientenautonomie sowie zwischen positivem und humanistischem Wissen verschwimmen. Diese Verschiebung führt zu einer kollaborativen Diagnosearbeit und einer neuen Form des medizinischen Professionalismus, genannt „integrierte medizinische Expertise“. Ärzte erkennen die Vorteile der Wissenssuche von Patienten an, fühlen sich jedoch teilweise unsicher und betonen die Bedeutung von Kommunikation und Empathie. Die Studie deutet darauf hin, dass diese Veränderungen die Arzt-Patient-Beziehung zu einer Partnerschaft transformieren, die sowohl liberale als auch nicht-liberale Werte integriert. (Meskó, Radó, und Győrffy 2019)
From Internet to Artificial Intelligence (AI) Bots: Symbiotic Evolutions of Digital Technologies and e-Patients ist eine Studie von Daniel Z. Sands und Nancy B. Finn, veröffentlicht am 4. Juni 2025 im Journal of Participatory Medicine. Sie beschreibt die symbiotische Entwicklung digitaler Technologien und des e-Patient-Konzepts, das Patienten als ausgestattet, befähigt, ermächtigt und engagiert charakterisiert. Beginnend mit dem World Wide Web und E-Mail über soziale Netzwerke, elektronische Gesundheitsakten, Patientenportale, Smartphones, patientengenerierte Gesundheitsdaten und Telemedizin bis hin zu Künstlicher Intelligenz werden aufeinander aufbauende Innovationen analysiert, die die Kommunikation, Kollaboration und Koordination zwischen Patienten und Klinikern verbessern. Die Autoren schlussfolgern, dass diese Technologien ein sichereres und patientenbedürfnisorientierteres Gesundheitssystem fördern.
Arzt-Patienten-Beziehung
Die Studie „The Impact of Web 2.0 on the Doctor-Patient Relationship“ von Bernard Lo und Lindsay Parham untersucht, wie Web-2.0-Technologien die Arzt-Patient-Beziehung verändern. Anhand des fiktiven Falls von Roger Jenkins, einem Diabetiker, der ein persönlich kontrolliertes Gesundheitsdossier (PCHR) nutzt, zeigt die Studie, wie solche Technologien die Selbstverwaltung von Gesundheitsdaten, den Zugang zu vertrauenswürdigen Informationen und die Kommunikation mit Ärzten verbessern können. Die Autoren analysieren ethische Herausforderungen, wie ungenaue Informationen, Datenschutzrisiken und mögliche Belastungen der Arzt-Patient-Beziehung, und schlagen Maßnahmen vor, um die Vorteile dieser Technologien zu maximieren und Risiken zu minimieren. Sie betonen die Notwendigkeit, Patientenautonomie zu fördern, die Qualität von Online-Informationen zu sichern und den Zugang für benachteiligte Gruppen zu verbessern. (Lo und Parham 2010)
Die Studie „Impact of Internet Use on Health-Related Behaviors and the Patient-Physician Relationship: A Survey-Based Study and Review“ von Iverson et al. untersucht das Verhalten von Patienten beim Suchen von Gesundheitsinformationen im Internet und dessen Auswirkungen auf Selbstfürsorge und die Arzt-Patient-Beziehung. In drei osteopathischen Primärversorgungskliniken wurden 154 Patienten befragt, von denen 58 % angaben, das Internet für Gesundheitsinformationen zu nutzen. Davon berichteten 55 % eine Veränderung ihrer Sichtweise auf ihre Gesundheit und 46 % gaben an, ihr Verhalten, z. B. durch häufigeres Stellen von Fragen oder Ernährungsumstellungen, angepasst zu haben. Die meisten Patienten (84 %) empfanden ihre Ärzte als offen für Diskussionen über Online-Informationen. Die Studie zeigt, dass Online-Recherchen die Eigenverantwortung der Patienten fördern können, aber auch Herausforderungen durch zusätzliche Fragen und mögliche Fehlinformationen mit sich bringen. (Iverson, Howard, und Penney 2008)
Die Studie „The Effect of Online Health Information Seeking on Physician-Patient Relationships: Systematic Review“ untersucht systematisch den Einfluss des Online-Suchverhaltens nach Gesundheitsinformationen (OHI) auf die Arzt-Patienten-Beziehung. Die Autoren analysierten 53 Studien (42 englische und 11 chinesische) und fanden heraus, dass OHI-Suchen in 58 % der Fälle die Arzt-Patienten-Beziehung positiv beeinflussen, indem sie Patienten eine aktive Teilnahme an ihrer Gesundheitsversorgung ermöglichen und die Therapietreue fördern. 26 % der Studien bewerten den Einfluss neutral, während 15 % negative Auswirkungen feststellen, insbesondere in China, wo geringe Gesundheitsinformationskompetenz, schlechte OHI-Qualität und kurze Kommunikationszeiten das Vertrauen in Ärzte mindern. Die Studie betont, dass die Verbesserung der Gesundheitsinformationskompetenz und der OHI-Qualität entscheidend ist, um positive Effekte zu fördern. (Luo u. a. 2022)
Die Studie „A mixed methods systematic review of the effects of patient online self-diagnosing in the ‘smart-phone society’ on the healthcare professional-patient relationship and medical authority“ von Annabel Farnood, Bridget Johnston und Frances S. Mair untersucht in einer systematischen Übersicht anhand qualitativer und quantitativer Arbeiten, wie sich das Online-Selbstdiagnostizieren von Patientinnen und Patienten auf das Verhältnis zu medizinischen Fachkräften und auf deren Autorität auswirkt. Die Ergebnisse zeigen, dass das Internet von Patientinnen und Patienten überwiegend als ergänzende Informationsquelle genutzt wird, während Ärztinnen und Ärzte weiterhin als verlässlichste Instanz angesehen werden. Online-Recherchen können die Patientenbeteiligung und die gemeinsame Entscheidungsfindung im medizinischen Gespräch fördern; jedoch bestehen seitens der Fachkräfte gemischte Einstellungen zu internetinformierten Patientinnen und Patienten, insbesondere im Hinblick auf Fehlinformationen und Zeitaufwand in der Sprechstunde. Insgesamt deutet die Studie darauf hin, dass das Suchverhalten im Internet das Vertrauensverhältnis zum medizinischen Personal stärken kann, sofern eine offene und respektvolle Kommunikation erfolgt. (Farnood, Johnston, und Mair 2020)
Die Studie mit dem Titel „Generative AI as Third Agent: Large Language Models and the Transformation of the Clinician-Patient Relationship“ untersucht, wie große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) die Beziehung zwischen Klinikern und Patienten verändern können. Die Autor:innen analysieren aus verschiedenen Perspektiven – darunter Patientenvertreter, Informatiker und klinische Experten – die Chancen und Herausforderungen durch den Einsatz von LLMs im Gesundheitswesen. Dabei wird beleuchtet, wie LLMs die Patientenkommunikation verbessern, die Entscheidungsfindung unterstützen und die Patienteneinbindung stärken können, aber auch Risiken wie Datenschutzprobleme, algorithmische Verzerrungen und den Verlust menschlicher Verbindungen mit sich bringen. Die Studie schlägt ein konzeptionelles Rahmenwerk vor, um zu verstehen, welche Aspekte der Beziehung zwischen Patient und Arzt menschlich bleiben müssen, und ruft zu einer ethisch fundierten, transparenten und patientenzentrierten Gestaltung solcher Technologien auf. So können LLMs als neues, drittes „Agenten“-Element in der klinischen Interaktion wirken und eine transformative Rolle in der partizipativen Medizin spielen. (O Campos u. a. 2025)
Die Studie mit dem Titel „The Evolution of Patient Empowerment and Its Impact on Health Care’s Future“ beschreibt die Entwicklung der Patientenermächtigung in den letzten 25 Jahren und analysiert deren Auswirkungen auf die zukünftige Gesundheitsversorgung. Sie untersucht, wie technologische Fortschritte wie das Internet, Smartphones und Künstliche Intelligenz die traditionelle Arzt-Patient-Beziehung von einem paternalistischen Modell hin zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit verändert haben. Die Arbeit identifiziert drei zentrale Säulen der Ermächtigung: Ressourcen, Handlungskompetenz und ein förderliches gesellschaftliches Umfeld. Zudem werden Chancen und Herausforderungen der Patientenermächtigung sowie deren Nutzen für Patienten und das Gesundheitssystem erörtert. Abschließend gibt die Studie einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und notwendige Veränderungen in Politik und Praxis. (Mesko u. a. 2025)
In der Studie “Artificial intelligence and the dehumanization of patient care” wird betont, dass die Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) in die Gesundheitsversorgung Vorteile in Diagnostik und Effizienz bietet, jedoch das Risiko birgt, die Arzt-Patienten-Beziehung zu untergraben. Die zunehmende Abhängigkeit von KI kann Interaktionen und das Vertrauen der Patienten schwächen, da datengetriebene Entscheidungen die menschliche Beziehung überlagern. Der „Black-Box“-Charakter vieler KI-Algorithmen mindert die Transparenz und damit das Vertrauen und Verständnis. Zudem können KI-Systeme, die auf unbalancierten Datensätzen trainiert wurden, gesundheitliche Ungleichheiten verstärken. Um dies zu verhindern, sollten zukünftige KI-Entwicklungen darauf abzielen, die menschlichen Aspekte zu berücksichtigen, anstatt sie zu ersetzen, um eine ausgewogene und patientenzentrierte Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. (Akingbola u. a. 2024)
Der Artikel „Regressing or progressing: what next for the doctor–patient relationship?“ von Natalie Harrison untersucht die Entwicklung der Arzt-Patienten-Beziehung über die Jahrhunderte. Er beleuchtet, wie technologische, sozioökonomische und politische Faktoren die Machtdynamik und den Wissensbesitz beeinflusst haben. Von der patientenzentrierten Medizin der Renaissance bis zur heutigen technologiegetriebenen Ära zeigt der Artikel, wie sich das Gleichgewicht zwischen Arzt und Patient verändert hat. Trotz Fortschritten hin zu mehr Patientenautonomie warnt der Artikel vor einer möglichen Rückkehr zur Krankheitszentrierung durch digitale Technologien. Die Zukunft der Beziehung hängt stark von der Integration humanistischer Ansätze und der Navigation durch Datenschutzsfragen ab. (Harrison 2018)
Das Kapitel 24 “Doctor–Patient Relationship” in Wiley Blackwell Companion to Medical Sociology, verfasst von Hyeyoung Oh Nelson und herausgegeben von William C. Cockerham, untersucht die Arzt-Patient-Beziehung als zentrales Element der Gesundheitsversorgung. Es beleuchtet die Entwicklung von medizinischer Paternalismus hin zu patientenzentrierter Versorgung und analysiert den Einfluss von Technologie und Patientenautonomie auf diese Beziehung. Die Rolle von Patienten und Ärzten hat sich durch Veränderungen im Gesundheitssystem stark gewandelt, wobei patientenzentrierte Ansätze und der Einfluss von Konsumerismus im Fokus stehen. (Oh Nelson 2021)
Die Arzt-Patient-Beziehung hat sich im Laufe der Zeit stark verändert, von einem paternalistischen Modell, in dem der Arzt die Entscheidungen traf, hin zu einem patientenzentrierten Ansatz, der auf gegenseitiger Partizipation basiert. Historisch entwickelte sich diese Beziehung von der Aktivität-Passivität in der Antike über die Kooperation im antiken Griechenland bis hin zur heutigen Betonung auf Empathie und geteilter Verantwortung. Moderne Herausforderungen wie der Einfluss des Internets und steigende Klagezahlen beeinflussen diese Dynamik weiter. Der patientenzentrierte Ansatz fördert eine gleichberechtigte Zusammenarbeit, bei der der Arzt die individuelle Perspektive des Patienten berücksichtigt, um eine effektive Behandlung zu gewährleisten. (Kaba und Sooriakumaran 2007)
Der Artikel “Erosion of the ’ethical’doctor-patient relationship and the rise of physician burn-out” von Atara Messinger und Sunit Das untersucht die Verbindung zwischen Arzt-Burnout und dem Verlust von Bedeutung in der Medizin durch den Zerfall der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen Ärzten und Patienten. Unter Berufung auf Emmanuel Levinas argumentieren die Autoren, dass Depersonalisation nicht nur eine Folge, sondern eine Hauptursache von Burnout sein könnte. Sie schlagen vor, dass ein personenzentrierter Ansatz, der die dialogische Dimension der Arzt-Patient-Beziehung betont, sowohl das Wohlbefinden der Patienten als auch der Ärzte fördern kann. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, die intersubjektive Beziehung zu stärken, um Burnout entgegenzuwirken. (Messinger und Das 2023)
Digitale Gesundheitstechnologien verändern die Arzt-Patienten-Beziehung, indem sie die Rollen und Verantwortlichkeiten beider Parteien neu definieren und die Entscheidungsfindung beeinflussen. Eine qualitative Interviewstudie mit 25 Teilnehmern (14 Gesundheitsfachkräfte, 11 Patientinnen) untersuchte die Auswirkungen einer digitalen Überwachungsplattform für hypertensive Störungen in der Schwangerschaft. Patientinnen gewinnen durch digitale Überwachung ein besseres Verständnis ihrer Erkrankung und können aktiv an geteilten Entscheidungsprozessen teilnehmen. Dennoch bleibt die klinische Entscheidungsfindung bei den Fachkräften, die die digitalen Daten entweder als objektive Grundlage für standardisierte Entscheidungen oder als kontextabhängige Daten für personalisierte Pflege betrachten. Die Studie zeigt, dass digitale Technologien subtile, doppelseitige Effekte haben, und schlägt sechs ethische Empfehlungen für ihre Implementierung vor, um die Balance zwischen Standardisierung und Individualisierung zu gewährleisten. (Jongsma u. a. 2021)
Die Implementierung digitaler Gesundheitstechnologien (eHealth) in der klinischen Praxis birgt ethische und rechtliche Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Verantwortlichkeiten von Ärzten. Im Rahmen einer multidisziplinären Studie (“Clarifying responsibility: professional digital health in the doctor-patient relationship, recommendations for physicians based on a multi-stakeholder dialogue in the Netherlands”) wurde die Unsicherheit über Verantwortlichkeiten als Hauptthema identifiziert, insbesondere in der Arzt-Patienten-Beziehung im Kontext „professioneller digitaler Gesundheit“. Ärzte stehen vor Dilemmata, da bestehende rechtliche Rahmenbedingungen und Verhaltenskodizes oft nicht ausreichen, um ihre Pflichten klar zu definieren. Es fehlt an spezifischer professioneller Leitlinie, und Unsicherheiten über Sicherheit, technische Zuverlässigkeit und Evidenz für digitale Gesundheitsanwendungen verstärken die Zurückhaltung. Die Studie schlägt Empfehlungen vor, wie etwa die aktive Rolle medizinischer Verbände bei der Unterstützung, die Förderung evidenzbasierter Technologien und eine klare Kommunikation über Risiken und Patientenverantwortlichkeiten, um die Einführung digitaler Gesundheit zu fördern und die Versorgungsqualität zu verbessern. (Silven u. a. 2022)
Der systematische Review „Physician Perspectives on Internet-Informed Patients: Systematic Review“ untersucht die Sichtweisen von Ärzten auf Patienten, die Gesundheitsinformationen aus dem Internet beziehen. Die Studie zeigt, dass Ärzte unterschiedliche Meinungen zu diesem Verhalten haben, von positiv bis negativ, wobei viele eine ausgewogene Sicht vertreten. Sie erkennen Vorteile wie gesteigertes Patientenwissen, aber auch Risiken wie Fehlinformationen und erhöhte Ängste. Ärzte nutzen entweder partizipative Strategien, um Patienten bei der Nutzung von Internetinformationen zu unterstützen, oder defensive Ansätze, um diese zu entmutigen. Herausforderungen umfassen Zeitdruck und fehlende Schulungen, weshalb Ärzte Fortbildungen und Informationen über vertrauenswürdige Websites wünschen. (Lu und Schulz 2024)
Neue Arzt-Patienten-Beziehung
Die systematische Übersichtsarbeit untersucht die Erfahrungen von Patienten mit der Kompetenz von Gesundheitsfachkräften in der digitalen Beratung. Durch die Analyse von 16 qualitativen Studien wurden drei Hauptergebnisse identifiziert: Erstens benötigen Fachkräfte Kompetenzen, um effiziente digitale Beratung bereitzustellen, einschließlich technischer Unterstützung und Problemlösung. Zweitens ist die Fähigkeit, Patienten bei der Selbstverwaltung ihrer Gesundheit zu unterstützen, entscheidend, indem sie klare Anweisungen und personalisierte Informationen bereitstellen. Drittens ist die Kompetenz, eine vertrauensvolle, reziproke Beziehung in digitalen Umgebungen aufzubauen, essenziell, um eine komfortable Atmosphäre zu schaffen und empathisch zuzuhören. Diese Erkenntnisse können die Ausbildung von Gesundheitsfachkräften verbessern und patientenzentrierte digitale Beratung fördern. (Kaihlaniemi u. a. 2024)
Vertrauen
Die Studie „People Overtrust AI-Generated Medical Advice despite Low Accuracy“ untersucht, wie nichtmedizinische Laien KI-generierte medizinische Antworten wahrnehmen und bewerten. In einer Untersuchung mit 300 Teilnehmern wurden Antworten von Ärzten und KI-Modellen mit hoher oder niedriger Genauigkeit verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass Teilnehmer KI-generierte Antworten oft nicht von ärztlichen unterscheiden konnten und diese sogar bevorzugten, selbst wenn sie ungenau waren. Dieses übermäßige Vertrauen in potenziell schädliche KI-Ratschläge könnte zu Fehldiagnosen und gesundheitlichen Risiken führen. Die Studie betont die Notwendigkeit, KI-Systeme in Zusammenarbeit mit medizinischen Fachkräften einzusetzen, um Fehlinformationen zu vermeiden. (Shekar u. a. 2025)
Der Artikel „Ethical Obligations to Inform Patients About Use of AI Tools“ von Michelle M. Mello und Kollegen behandelt die ethischen Verpflichtungen im Gesundheitswesen, Patienten über den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in ihrer Behandlung zu informieren. Er stellt ein Rahmenwerk vor, das Gesundheitsorganisationen dabei unterstützt zu entscheiden, wann und wie Patienten über KI-Tools benachrichtigt oder um Zustimmung gebeten werden sollten. Dabei werden vor allem der potenzielle Schaden für Patienten und ihre Möglichkeit, auf die Information zu reagieren, als zentrale Kriterien herangezogen. Der Artikel betont, dass nicht jede KI-Anwendung offengelegt werden muss, um Patienten nicht mit Informationen zu überfluten, und plädiert für ausgewogene Transparenz- und Zustimmungsregelungen, die Patientenrechte wahren und zugleich eine sichere und effektive Versorgung gewährleisten. (Mello, Char, und Xu 2025)
Das PIF TICK ist ein Qualitätszeichen für vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen im Vereinigten Königreich, vergeben von der Patient Information Forum (PIF). Es kennzeichnet evidenzbasierte, aktuelle und leicht verständliche Gesundheitsinformationen. Auf der aktualisierten PIF TICK-Website können Nutzer zertifizierte Informationsanbieter nach Gesundheitsthemen durchsuchen, wie z. B. Wellness-Ressourcen zur Förderung von Selbstfürsorge und Stressbewältigung. PIF bietet zudem Leitfäden, ein Verzeichnis zertifizierter Anbieter und Informationen für Fachkräfte. Die Organisation feiert 2025 fünf Jahre PIF TICK und setzt sich gegen Gesundheitsdesinformation ein.
Ungleichheit
Die Studie mit dem Titel „Can health information and decision aids decrease inequity in health care? A systematic review“ untersucht, inwieweit evidenzbasierte Gesundheitsinformationen (EBHI) und Patienten-Entscheidungshilfen (PtDAs) unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gleichermaßen bei informierten Entscheidungen unterstützen. In zwölf randomisierten kontrollierten Studien wurden Faktoren wie Ethnie, Bildung, sozioökonomischer Status, Gesundheitskompetenz und Alter analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass EBHI und PtDAs insgesamt wirksam sind, jedoch nur wenige Studien gezielt Unterschiede zwischen benachteiligten und privilegierten Gruppen betrachteten. Die Studie betont die Notwendigkeit, zukünftige Forschungsarbeiten besser auf die Berücksichtigung von Ungleichheiten auszurichten, um eine gerechte Gesundheitsversorgung sicherzustellen. (Ellermann u. a. 2025)
Assistenzsysteme
Die Studie mit dem Titel „Perspectives From Canadian People With Visual Impairments in Everyday Environments Outside the Home: Qualitative Insights for Assistive Technology Development“ untersucht die Herausforderungen und Unterstützungsfaktoren, denen Menschen mit Sehbehinderungen in alltäglichen, öffentlichen Innenräumen in Kanada begegnen. Durch qualitative Fokusgruppen wurden Barrieren wie unzugängliche Beschilderungen und Schwierigkeiten bei der Orientierung identifiziert, während menschliche Hilfe, Vorbereitung und zugängliche Umgebungen als wichtige Erleichterungen hervorgehoben wurden. Die Studie zeigt, dass moderne Assistenztechnologien, insbesondere Smartphone-Apps, zwar hilfreich sein können, jedoch die menschliche Unterstützung und die physische Umgebung für die Unabhängigkeit der Betroffenen oft entscheidender sind. Gleichzeitig werden Empfehlungen für die Entwicklung nutzerfreundlicher und barrierefreier Technologien gegeben, die die Bedürfnisse der Nutzer besser berücksichtigen. (Puri u. a. 2025)
Personalisierte Medizin
Die Studie mit dem Titel „Developing a Behavioral Phenotyping Layer for Artificial Intelligence–Driven Predictive Analytics in a Digital Resiliency Course: Protocol for a Randomized Controlled Trial“ beschreibt die Planung eines randomisierten kontrollierten Versuchs (RCT) zur Entwicklung von Verhaltensprofilen mithilfe künstlicher Intelligenz. Ziel ist es, die Personalisierung digitaler psychischer Gesundheitsangebote zu verbessern, insbesondere für ukrainische Geflüchtete, die an einem resilienzfördernden Online-Kurs teilnehmen. Sechs unterschiedliche Interventionsarme vergleichen verschiedene Kombinationen von Verhaltenstips, Checklisten und Gamification-Elementen, um die Nutzerbindung zu messen und daraus Vorhersagemodelle zu erstellen. Die wissenschaftliche Evaluation umfasst das Nutzerengagement, Kursabschlussraten und weitere Verhaltensmetriken. Die Studie wurde sorgfältig ethisch geprüft und so konzipiert, dass sie Datenschutz gewährleistet sowie in mehreren Sprachen adaptiert ist. (Mierlo u. a. 2025)
Die Studie mit dem Titel “AI and Digital Health: Personalizing Physical Activity to Improve Population Health” beschäftigt sich mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Gesundheitstechnologien, um körperliche Aktivität individuell zu personalisieren. Ziel ist es, durch maßgeschneiderte Empfehlungen das Bewegungsverhalten von Menschen zu verbessern und dadurch die Gesundheit auf Bevölkerungsebene zu fördern. Die Studie untersucht, wie personalisierte Aktivitätsempfehlungen, die mithilfe von KI generiert werden, die Einbindung und Wirksamkeit im Vergleich zu allgemeinen Richtlinien erhöhen können. Damit wird ein innovativer Ansatz vorgestellt, der physische Aktivität relevanter und zugänglicher macht und somit potenziell einen positiven Beitrag zur öffentlichen Gesundheitsvorsorge leisten kann. (Kim, Rodriguez, und Ashley 2025)
Digitalkompetenz
Die Studie „There’s a creepy guy on the other end at Google!: engaging middle school students in a drawing activity to elicit their mental models of Google“ untersucht, wie Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe sich vorstellen, wie die Suchmaschine Google funktioniert. Im Rahmen des außerschulischen HackHealth-Programms wurden 26 Teilnehmende im Alter von 10 bis 14 Jahren gebeten, mithilfe von Zeichnungen und kurzen Beschreibungen ihre mentalen Modelle von Googles Funktionsweise darzustellen. Die Analyse der Zeichnungen ergab eine Typologie mit sechs Kategorien, darunter „Google als Menschen“, „Google als physischer Raum“, „Google als technische Geräte“ und „Google als Code“. Die Ergebnisse zeigen, dass das Verständnis der Jugendlichen über die technischen Prozesse hinter Google oft lückenhaft und stark von Anthropomorphismus geprägt ist. Die Autorinnen und Autoren betonen, dass diese Erkenntnisse für die Gestaltung von Informations- und Digitalkompetenzunterricht sowie für eine transparentere Suchmaschinengestaltung genutzt werden können. (Kodama u. a. 2017)
Online Gesundheitsgemeinschaften
Das 2022 in Social Science & Medicine veröffentlichte Paper von Roberta Bernardi und Philip F. Wu untersucht, wie Patienten in Online-Gesundheitsgemeinschaften (OHCs) mit den Spannungen zwischen der Logik persönlicher Wahl und der Logik medizinischer Professionalität umgehen. Basierend auf 44 Interviews mit Mitgliedern einer OHC für Diabetiker zeigt die Studie, dass Patienten durch OHCs alternative Behandlungsoptionen kennenlernen und ihre Entscheidungsfreiheit stärken, was jedoch Konflikte mit der Autorität von Gesundheitsfachkräften hervorrufen kann. Patienten handeln strategisch, indem sie OHC-Ratschläge selektiv mit Ärzten teilen, abhängig von deren Offenheit für die Logik persönlicher Wahl. Die Studie betont, dass Patienten durch geschicktes Management dieser Logiken ihre Beziehung zu Ärzten aufrechterhalten und von OHCs profitieren können, ohne diese zu gefährden. (Bernardi und Wu 2022)
Weiteres
Die Studie „Effectiveness of an Interactive Digital Intervention Program on Knowledge, Health Literacy, and Learner Engagement in Senior High School Students: Intragroup and Intergroup Comparison of 2 Teaching Models“ untersuchte die Wirksamkeit eines interaktiven digitalen Interventionsprogramms (IDI) zur Prävention von Substanzkonsum bei 651 Schülern im Alter von 16 bis 18 Jahren aus neun taiwanesischen Schulen. In einem quasi-experimentellen Pre-Post-Design wurde das IDI mit sechs webbasierten Einheiten (inklusive Videos, Quizzen und Szenario-Diskussionen) einem traditionellen Lehrbuchunterricht gegenübergestellt. Die IDI-Gruppe zeigte signifikante Verbesserungen in Wissen, Gesundheitskompetenz (funktional, kritisch, kommunikativ) und Lernengagement (kognitiv und emotional), während intergruppale Vergleiche die Überlegenheit des digitalen Ansatzes unterstrichen, wenngleich nicht alle Zielvariablen wie Ablehnungsfähigkeiten gleichermaßen profitierten.
Das Buch „Personalized Medicine: Empowered Patients in the 21st Century?“ von Barbara Prainsack, Professorin für Vergleichende Politikanalyse an der Universität Wien, erschien 2017 bei New York University Press. Es untersucht die zunehmende Beteiligung von Patienten an Diagnose, Behandlung und Medikation im Kontext datengetriebener personalisierter Medizin. Prainsack analysiert, wie diese Entwicklung zu einem technologiezentrierten Individualismus führen kann, aber auch Chancen für Solidarität bietet. Das Werk integriert empirische Arbeiten und kritische Analysen aus Medizin, Public Health, Datenwissenschaft, Bioethik und digitaler Soziologie. Es plädiert für eine Personalisierung, die patientenorientiert bleibt und nicht von Technologien dominiert wird.
Die Studie „The “We” in the “Me”: Solidarity and Health Care in the Era of Personalized Medicine“ von Barbara Prainsack kritisiert die gängige Annahme in rechtlichen und ethischen Instrumenten der Gesundheitsversorgung, wonach Personen ideale, unabhängige und strategisch rationale Individuen sind. Diese Sichtweise erweist sich als ungeeignet, da sie die relationale Natur des Menschen vernachlässigt und konkrete Probleme in der Medizin verursacht. Prainsack schlägt eine solidaritätsbasierte Perspektive vor, die relationale Ansätze betont und neue Lösungen für ethische und regulatorische Fragen ermöglicht, etwa in der Sterbebegleitung, bei Organspenden oder der Gesundheitsdatennutzung. Sie unterstreicht die Bedeutung universeller Gesundheitsversorgung und zeigt, wie individuelle Rechte durch gemeinsame soziale Praktiken geformt werden, um eine übermäßige Individualisierung in der personalisierten Medizin zu vermeiden.
Die Studie „Public Perception of Physicians Who Use Artificial Intelligence“ (Reis M et al., JAMA Netw Open 2025;8(7):e2521643) untersuchte in einem randomisierten Online-Experiment mit 1276 US-Erwachsenen, wie die Erwähnung von KI-Nutzung in Arztwerbung die Wahrnehmung von Hausärzten beeinflusst. Teilnehmer bewerteten fiktive Arztanzeigen, die entweder keine Angabe zur KI enthielten (Kontrollbedingung) oder explizit KI für administrative, diagnostische oder therapeutische Zwecke nannten. In allen drei KI-Bedingungen wurden die Ärzte signifikant schlechter hinsichtlich Kompetenz, Vertrauenswürdigkeit und Empathie eingestuft sowie eine geringere Bereitschaft bekundet, einen Termin zu vereinbaren, als in der Kontrollbedingung. Die Effekte waren über die drei KI-Anwendungsbereiche vergleichbar; die Bereitschaft zur Terminvereinbarung sank am stärksten. Die Autoren schlussfolgern, dass die bloße Erwähnung von KI-Nutzung – unabhängig vom Anwendungskontext – bei der Öffentlichkeit zu Vorbehalten führt und empfehlen transparente Kommunikation der Vorteile für Patienten.
Der Artikel „Collaborative Design and Development of a Patient-Centered Digital Health App for Supportive Cancer Care: Participatory Study“ wurde am 11. November 2025 in JMIR Human Factors (Vol 12, e73829) veröffentlicht. Die Studie beschreibt die partizipative Entwicklung einer patientenzentrierten mHealth-App namens OncoSupport+ am Universitätsspital Zürich in Zusammenarbeit mit Krebspatienten, Patientenvertretern und Fachpersonal. In einem dreiphasigen Co-Design-Prozess (Predesign, Generative Phase, Prototyping) wurden Bedürfnisse erhoben, Funktionen priorisiert und ein Prototyp erstellt, der ein Patienten-Dashboard zur Erfassung von Patient-reported Outcome Measures (PROMs) sowie personalisierten Informationen und ein Pflegekräfte-Dashboard zur Visualisierung der Daten umfasst. Die App zielt auf verbesserte Kommunikation, Digitalisierung von Supportive-Care-Prozessen und Steigerung der Selbstwirksamkeit ab; wesentliche Akzeptanzfaktoren sind Benutzerfreundlichkeit, Workflow-Integration und professionelle Einführung. Die Autoren betonen die Notwendigkeit einer konsequenten Einbindung von Patienten und Klinikpersonal, um eine erfolgreiche Implementierung digitaler Werkzeuge in der supportiven Krebsversorgung zu gewährleisten.
VYVYT hat sich auf die digitale Bewahrung und Weitergabe von Erinnerungen an verstorbene Menschen spezialisiert hat. Unter dem Leitspruch „er|sie|es lebt weiter“ (abgeleitet vom lateinischen „vivit“) entwickelt das Team um Lilli Berger und Anton Krause KI-basierte Produkte wie ERINNERUNGS|PODCAST (Lebensgeschichten als persönlicher Audio-Podcast), ERINNERUNGS|RAUM (virtuelle 3D-Gedenkräume) sowie ERINNERUNGS|FEIER (virtuelle Trauerfeiern). Ergänzend werden kostenlose monatliche Virtual Meetups zum Thema „KI in Trauer“, eine jährliche Masterclass (89 €) zur eigenständigen Erstellung von Griefbots, 3D-Räumen und KI-Podcasts sowie die Beteiligung an der Trauerwoche angeboten. Das Unternehmen versteht sich als Pionier im Bereich digitaler Trauerkultur.
Das “DNVF Memorandum Partizipative Versorgungsforschung” des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung e.V. (DNVF) bietet einen Überblick über den Entwicklungs- und Forschungsstand sowie die Umsetzung partizipativer Ansätze in der Gesundheitsversorgungsforschung,. Das zentrale Anliegen ist die aktive Einbindung von Patient:innen und weiteren Stakeholdern, wie etwa Fachkräften aus der Versorgungspraxis, in die Prozesse der Versorgungsforschung, um die Patient:innenrelevanz und die bedarfsgerechte Qualität der Gesundheitsversorgung zu steigern,. Das Memorandum beschreibt die Charakteristika partizipativer Versorgungsforschung, stellt ihren Entwicklungs- und Institutionalisierungsstand in Deutschland dar und beleuchtet das Potential und die Vorteile dieses Ansatzes. Zudem befasst sich der erste Teil mit zwei relevanten Querschnittsthemen, nämlich der theoretischen und konzeptionellen Fundierung sowie der Untersuchung von Effekten und Wirksamkeit partizipativer Ansätze.
Das Webinar „The e-Patient Evolution: How Digital Health is Redefining Patient Engagement“, das in Zusammenarbeit mit der Society for Participatory Medicine stattfand, präsentierte eine Expertenrunde, die die symbiotische Co-Evolution von E-Patienten und digitaler Gesundheit diskutierte. Im Zentrum steht die These, dass E-Patienten – informierte Gesundheitskonsumenten, die online Informationen suchen und mit Ärzten kooperieren – Technologie nutzen, um Innovationen in der digitalen Gesundheit voranzutreiben und die Patientenbeteiligung neu zu definieren. Die Diskussionsteilnehmer erörterten, wie E-Patienten im Laufe der letzten 25 Jahre verschiedene Technologien, von Web-Suchen über tragbare Geräte bis hin zu künstlicher Intelligenz (KI), auf unerwartete Weise eingesetzt haben, was eine fortlaufende Innovation befeuert. Dabei wurden wiederkehrende Themen wie die Notwendigkeit des Patient Empowerment, die Nutzung der Patientenintelligenz als untergenutzte Ressource im Gesundheitswesen und die Herausforderungen des digitalen Grabens behandelt.
Der Artikel „Digital Information Sharing Before Consultations in General Practice: Protocol for a Scoping Review“ beschreibt das Protokoll einer Scoping Review, die den Einsatz digitaler Tools zur vorab stattfindenden Informationsübermittlung durch Patienten in der Allgemeinmedizin untersucht. Ziel ist es, die vorhandene Evidenz zu diesen Systemen – wie Accurx oder eConsult – systematisch zu kartieren, ihre Implementierung, Auswirkungen auf Gesundheitsungleichheiten und klinische Ergebnisse zu beschreiben sowie Forschungslücken zu identifizieren. Die Review folgt den Richtlinien der Joanna Briggs Institute und PRISMA-ScR, umfasst Literatur ab 2021 aus Datenbanken und Grauer Literatur und sieht eine narrative Synthese der Ergebnisse vor. Die Suche ergab nach Deduplizierung 4536 Treffer; die Volltextprüfung wurde im November 2025 abgeschlossen, die Ergebnisse sollen Anfang 2026 publiziert werden.
Stelle mappinfo in einem kurzen Absatz von Sätzen vor und erwähnen im ersten Satz den Titel und schreibe in deutscher Sprache sachlich nüchtern objektiven
“MAPPinfo – Validated checklist for the assessment of evidence-based health information” ist ein Instrument zur systematischen Bewertung der Qualität von Gesundheitsinformationen über medizinische Entscheidungen auf wissenschaftlicher Grundlage. Es operationalisiert erstmals das Qualitätskonzept der „Guideline Evidence-Based Health Information“ und prüft Gesundheitsinformationen anhand von Kriterien zu Definition, Transparenz, Inhalt und Präsentation, darunter etwa Zielgruppendefinition, Offenlegung von Finanzierung und Interessenkonflikten, Darstellung von Nutzen, Schaden und Unsicherheit. Die Checkliste ist ohne vertiefte medizinische Kenntnisse konzipiert und kann als Screening-Instrument genutzt werden, um Stärken und Schwächen von Gesundheitsinformationen zu identifizieren.
Der Artikel „Digital Health Technologies: Learnings and Perspectives From a Patient Engagement Stakeholder Expectations Matrix Study“ ist eine im Dezember 2025 im Journal of Medical Internet Research veröffentlichte Perspektivenarbeit. Er untersucht den aktuellen Stand der Patientenbeteiligung (Patient Engagement) in der Entwicklung und Umsetzung digitaler Gesundheitstechnologien. Basierend auf 37 qualitativen Interviews mit Stakeholdern aus sechs Gruppen sowie Erkenntnissen aus dem Patient Engagement Open Forum hebt der Beitrag unterschiedliche Perspektiven hervor, identifiziert Barrieren wie fehlendes gemeinsames Verständnis, fragmentierte Datengovernance und unzureichende Infrastruktur und weist auf Chancen für eine stärkere multistakeholder-Kollaboration hin, um ein inklusiveres, patientenzentriertes digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen.
“Investing in Healthcare’s Power Users – 2025 Research Report” wurde von Ingeborg Investments verfasst. Der Bericht führt das Konzept der “Healthcare Power User” ein – Nutzer, die Gesundheitsdienstleistungen häufiger und intensiver in Anspruch nehmen. Im Zentrum steht die These, dass Frauen die eigentlichen Power User im Gesundheitswesen sind: Sie konsumieren Gesundheitsleistungen 1,75-mal häufiger als Männer und nutzen Versorgungskanäle deutlich aktiver, werden jedoch durch systemische Barrieren beim Zugang und bei der Therapietreue behindert. Der Bericht analysiert einen Gesundheitsmarkt von 3,5 Billionen US-Dollar jährlich, wobei Frauen etwa 2,1 Billionen Dollar (60 Prozent) der Ausgaben verursachen. Auf dieser Grundlage identifiziert Ingeborg Investments acht zentrale Investmentthesen für die kommende Dekade, darunter hormonelle Gesundheitslösungen, KI-gestützte Triage, Umweltgesundheit, Cash-Pay-Modelle für Früherkennung sowie die Wiederbelebung der Primärversorgung durch Longevity-Konzepte. Das Dokument verbindet Marktanalyse mit einem dezidiert auf Frauen fokussierten Investmentansatz.
Trauerbots, auch als Griefbots oder Deathbots bekannt, sind KI-basierte Chatbots, die die Sprache und Persönlichkeit Verstorbener nachahmen, um Hinterbliebenen Kommunikation zu ermöglichen. Die Evidenzlage bleibt begrenzt und überwiegend theoretisch-ethisch geprägt. Psychoanalytisch wird in „Mourning, Melancholia and Machines: An Applied Psychoanalytic Investigation of Mourning in the Age of Griefbots“ gewarnt, dass sie den Trauerprozess verzögern oder verzerren könnten, indem sie die Akzeptanz des endgültigen Verlusts erschweren. Ethisch diskutiert „The Ethics of ‘Deathbots’“ Risiken für Autonomie, Abhängigkeit und kommerzielle Ausnutzung, mit Empfehlung einer Klassifikation als medizinische Produkte. Zu Online-Bereavement-Interventionen zeigen „Web-Based Bereavement Care: A Systematic Review and Meta-Analysis“ moderate bis große Effekte kognitiv-verhaltenstherapeutischer Ansätze auf Trauersymptome, „A Rapid Review of the Evidence for Online Interventions for Bereavement Support“ hohe Akzeptanz bei möglichen negativen Effekten, und „My Grief App for Prolonged Grief in Bereaved Parents: A Randomised Waitlist-Controlled Trial“ stabile Reduktionen depressiver Symptome. Spezifisch zu Trauerbots fehlen jedoch randomisierte kontrollierte Studien, sodass Nutzen und Risiken evidenzbasiert nicht abschließend bewertet werden können. Die Integration erfordert Vorsicht unter ethischen und regulatorischen Aspekten.
„Intervention in Health Misinformation Using Large Language Models for Automated Detection, Thematic Analysis, and Inoculation: Case Study on COVID-19“ ist eine im Januar 2026 im Journal of Medical Internet Research veröffentlichte Studie. Sie stellt ein automatisiertes System vor, das große Sprachmodelle nutzt, um Gesundheitsdesinformationen in sozialen Medien zu erkennen, zu klassifizieren und thematisch zu analysieren. Das Verfahren kombiniert die Erkennung von Fehlinformationen (mit einer BERT-basierten Klassifikation von 98 % Genauigkeit), Topic-Modeling mittels BERTopic zur Identifikation zentraler Themen sowie Prompt-Engineering, um satzbasierte Themenbeschreibungen und passende Widerlegungsargumente (Inokulation) zu erzeugen. Die Methode wurde an COVID-19-bezogenen englischsprachigen Daten getestet und zielt darauf ab, die Verbreitung von Fehlinformationen effektiv einzudämmen und das öffentliche Gesundheitsbewusstsein zu stärken.
„Trends in the Implementation of the Cyberchondria Severity Scale: Bibliometric Analysis“ ist eine im Januar 2026 in JMIR Mental Health veröffentlichte bibliometrische Studie von Adam C. Powell und Cayetana Calderon-Smith. Die Autoren untersuchten anhand von 117 englischsprachigen empirischen Artikeln aus den Jahren 2019 bis 2024, in welchem Umfang die originale 33-Item Cyberchondria Severity Scale (CSS) und ihre verkürzte 12-Item-Version (CSS-12) zur Messung von Cyberchondrie eingesetzt werden. Etwa 36 % der Studien nutzten die originale CSS, 33 % die CSS-12 und 31 % andere oder unbekannte Varianten. Während sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen Erscheinungsjahr und Instrumentenwahl zeigte, nahm der relative Anteil der CSS-12 im Zeitverlauf tendenziell zu. Es bestand ein hochsignifikanter Zusammenhang zwischen der Sprache des eingesetzten Instruments und der gewählten Skalenversion, was auf kulturelle und sprachliche Einflüsse bei der Instrumentenauswahl hinweist.
„Online Health Information–Seeking Among Older Adults and Predictors of Use, Motivations, and Barriers in the Context of Healthy Aging: Cross-Sectional Study“ ist eine im Januar 2026 veröffentlichte Querschnittsstudie aus der Schweiz. Sie untersucht das Verhalten von 1261 Internetnutzern ab 60 Jahren hinsichtlich der Suche nach Gesundheitsinformationen im Internet (OHIS). Rund 77,6 % der Befragten nutzen OHIS regelmäßig. Wichtige Prädiktoren für die Nutzung sind hohe digitale Kompetenz, häufige Internetnutzung und Vertrauen in Online-Gesundheitsinformationen. Die häufigste Motivation ist das bessere Verständnis von Erkrankungen. Bei Nichtnutzern dominieren hingegen Schwierigkeiten bei der Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit, Misstrauen gegenüber den Inhalten sowie Bedenken vor fragwürdigen Anbietern. Gesundheitskompetenz (Health Literacy) zeigte keinen signifikanten Einfluss, während digitale Kompetenz als zentraler Faktor hervorgehoben wird.
„Generation Silver Surfer“ ist eine Presseinformation des Digitalverbands Bitkom e.V. vom 15. Januar 2026. Die Veröffentlichung stellt die Ergebnisse einer repräsentativen Studie vor, für die 1.004 Personen ab 65 Jahren in Deutschland befragt wurden. Aktuell nutzen 74 Prozent der über 65-Jährigen das Internet – ein deutlicher Anstieg gegenüber 48 Prozent im Jahr 2020 und 38 Prozent im Jahr 2014. Die Mehrheit steht der Digitalisierung positiv gegenüber, wünscht sich ein schnelleres Tempo und fordert gleichzeitig mehr Unterstützungsangebote, um die eigenen Digitalkompetenzen zu verbessern, die im Durchschnitt nur mit der Note 3,2 bewertet werden.
Das Buch “Patient Involvement in Health Technology Assessment, Second Edition”, herausgegeben von Karen M. Facey, Anke-Peggy Holtorf und Ann N.V. Single, ist ein Fachwerk innerhalb der Reihe “Health Informatics”, das die systematische Einbeziehung von Patienten in die Bewertung von Gesundheitstechnologien (Health Technology Assessment, HTA) untersucht. In insgesamt 33 Kapiteln, an denen 121 internationale Autoren mitgewirkt haben, werden theoretische Konzepte, Forschungsmethodiken sowie praktische Fallbeispiele aus über 20 verschiedenen Rechtsordnungen weltweit dargelegt. Das Werk definiert Patienteneinbindung als ein zweigeteiltes Konzept, das sowohl die Forschung zu Patientenaspekten (wie Erfahrungen und Präferenzen) als auch die aktive Beteiligung von Patienten an HTA-Prozessen und der Politikgestaltung umfasst. Als Open-Access-Publikation richtet es sich an Akademiker, politische Entscheidungsträger und Patientenvertreter mit dem Ziel, die Relevanz, Legitimität und Transparenz von Entscheidungen im Gesundheitswesen durch die Nutzung von Patientenwissen zu erhöhen. Dabei werden spezifische methodische Ansätze wie Patientenpräferenzstudien, qualitative Evidenzsynthesen und die Analyse von sozialen Medien detailliert beschrieben.
Der Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit und stellt keine Rechtsberatung dar. Anmerkungen können in der rechten Seitenleiste mit Hypothes.is sozialem Annotierungswerkzeug oder am unteren Ende einer Seite mit GitHub Giscus Diskussionen hinterlassen werden.