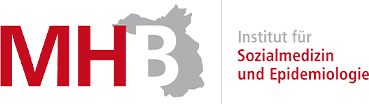Herz- & Kreislaufmedizin
Angiologie
trackPAD (Rocket Apes GmbH) zielt auf die Unterstützung von Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit (pAVK) ab. In den Bereichen Gesundheitsmanagement und wissenschaftliche Forschung bietet die App durch Gamification und Schrittzähler eine Möglichkeit, Patienten zu motivieren, ihre Gehtrainings durchzuführen, was direkt zur Verbesserung ihrer Lebensqualität beiträgt. Für Forscher ist trackPAD ein wertvolles Werkzeug, indem es Daten für wissenschaftliche Analysen durch mobilen Datensammlungsansatz bereitstellt.
LipoCheck App (LipoCheck GmbH) konzentriert sich auf das Management von Lipödem, einer Erkrankung, die hauptsächlich Frauen betrifft. Die App deckt die Bereiche Diagnose, Therapie und Selbstmanagement ab, sowie die Dokumentation von Symptomen und Therapien. Sie bietet Lipödem-Patientinnen umfassende Unterstützung durch Gesundheitsinformationen, Ernährungsrezepten, Übungsplänen und Zugang zu einem Netzwerk von Spezialisten. Für Ärzte erleichtert die App die Kommunikation und Dokumentation durch die Bereitstellung von Arztbriefen und Therapieempfehlungen.
biolitec App (biolitec AG) ist darauf ausgelegt, medizinische Fachkräfte bei der Anwendung von Lasertherapien in verschiedenen medizinischen Bereichen wie Urologie, Phlebologie, HNO und Ästhetik zu unterstützen und Erfahrungen auszutauschen.
Dopplex Vascular Reporter von Huntleigh Healthcare unterstützt die Gefäßdiagnostik durch die Visualisierung und Dokumentation von Doppler-Untersuchungen. Mit dieser Software können Ärzte Wellenformen in Echtzeit analysieren, speichern und drucken
| Software | Anbieter | URL | |
|---|---|---|---|
| 0 | trackPAD | Rocket Apes GmbH | rocket-apes.com/apps/trackpad |
| 1 | LipoCheck App | LipoCheck GmbH | lipocheck.de/lipodem-app |
| 2 | biolitec App | biolitec AG | biolitec.de/biolitec-app |
| 3 | Dopplex Vascular Reporter | Huntleigh Healthcare | huntleigh.de |
Die Webseite cholesterin-neu-verstehen.de bietet Informationen rund um das Thema Cholesterin, dessen Bedeutung für die Gesundheit und den Umgang damit. Sie klärt über die Rolle von Cholesterin im Körper, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Möglichkeiten zur Senkung hoher Cholesterinwerte auf. Die Inhalte sind leicht verständlich und richten sich an Menschen, die mehr über Cholesterinmanagement, Ernährung und einen gesunden Lebensstil erfahren möchten.
Bluthochdruck
| Software | Anbieter | URL | |
|---|---|---|---|
| 0 | Vantis | KHK und Herzinfarkt | G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG |
| 1 | actensio | mementor DE GmbH | actens.io |
| 2 | Hypertonie.App | Hypertension Care UG | www.hypertonie.app |
Die Studie „Machbarkeit und Wirksamkeit eines ringförmigen Blutdruckmessgeräts im Vergleich zu einem 24-Stunden-Ambulanzblutdruckmonitor“ untersucht die Genauigkeit des ringförmigen, manschettenlosen Geräts CART-I Plus im Vergleich zum herkömmlichen 24-Stunden-Blutdruckmonitor (ABPM). Dabei trugen 33 Teilnehmer beide Geräte gleichzeitig am selben Arm. Die Ergebnisse zeigten, dass das CART-I Plus verlässliche Blutdruckwerte liefert, die eng mit denen des ABPM übereinstimmen, insbesondere bei Messungen über den Tag und die Nacht hinweg. Das Gerät basiert auf Photoplethysmographie und bietet kontinuierliche und komfortable Blutdrucküberwachung. (Lee u. a. 2024)
Die Deutsche Hochdruckliga bietet Informationsmaterial zum Thema Bluthochdruck zum Download und in gedruckter Form an. Dazu gehören Infobroschüren, Plakate, Blutdruck-Tagebücher und Quizkarten in verschiedenen Formaten und Sprachen, die sich an Patientinnen, Mitarbeitende und Fachpersonal richten. Themen umfassen Prävention, Lebensstilmaßnahmen, Blutdruckmessung und spezielle Aspekte wie Hypertonie in der Schwangerschaft oder bei Kindern.
Kardiologie
Die Pocket-Leitlinien Anwendungen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und der European Society of Cardiology machen kardiologische Leitlinien auf digitalen Endgeräten zugänglich und verfügbar.
Die Arbeitsgruppe Telemonitoring (AG 33) der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK), gegründet 2005, widmet sich der Entwicklung und Umsetzung von medizinischen, technologischen, logistischen, datenschutzspezifischen und rechtlichen Standards für die Telemedizin in der Kardiologie. Unter der Leitung von ärztlichen Vertretern fokussiert die Gruppe Themen wie klinische Voraussetzungen, technische Anforderungen, Logistik von Telemonitoring-Zentren, Datenschutz und rechtliche Rahmenbedingungen. Sie fördert zudem wissenschaftliche Analysen und die Zusammenarbeit mit der Industrie zur Weiterentwicklung von Geräten. Die AG umfasst ein Expertengremium aus renommierten Kardiologen und Elektrophysiologen.
Die Sektion eCardiology der DGK bündelt die Digital Health-Aktivitäten der Gesellschaft. Sie widmet sich der fortschreitenden Digitalisierung der Kardiologie, die durch Algorithmen und Big Data die Versorgung von Herz-Kreislaufpatienten effizienter und qualitativer gestaltet. Fünf Teil-Ausschüsse befassen sich mit Themen wie transsektorale Zusammenarbeit, Mobile Health und Precision Digital Health.
myon.coach ist eine digitale Plattform zur Unterstützung und Überwachung von Herz-Kreislauf-Patienten, die den Austausch zwischen Patient:innen und medizinischem Fachpersonal erleichtert. Über die myoncare App oder Web-App können Gesundheitsdaten wie Blutdruckwerte, Medikamenteneinnahmen und Nachrichten sicher übermittelt werden. Ärzt:innen erhalten Benachrichtigungen, können den Gesundheitsstatus in Echtzeit überwachen und Therapiepläne individuell anpassen. Ziel ist es, die Therapieadhärenz zu verbessern, Komplikationen früh zu erkennen und Patient:innen zu mehr Selbstmanagement zu befähigen.
„Aktuelle Kardiologie“ (2025; 14(05): 390-398) beleuchtet im Artikel „Struktur und Umsetzung des Telemonitorings bei Herzinsuffizienz in Deutschland“ die Ergebnisse einer Befragung des Bundesverbandes Niedergelassener Kardiologen e.V. (BNK). Die Autoren zeigen, dass Telemonitoring seit 2022 in der Regelversorgung etabliert ist und klinische Vorteile bietet. Dennoch bestehen Unterschiede in der Struktur telemedizinischer Zentren hinsichtlich Größe, Personal und Technik. Ein Hauptproblem ist die geringe Einbindung externer Ärzte aufgrund unzureichender Vergütung. Strukturelle und technische Anpassungen sind nötig, um die Versorgung zu verbessern.
Forschung
Das Cardiovascular Data Science Lab (CarDS) an der Yale University treibt Innovationen in der kardiovaskulären Versorgung durch angewandte Datenwissenschaft und KI voran u.a. in der Entwicklung von Tools wie AI-Echo, AI-ECG und CarDSPlus.
Bluthochdruck
Der Artikel “Benefits and Barriers to mHealth in Hypertension Care: Qualitative Study With German Health Care Professionals” untersucht die Perspektiven von Gesundheitsfachkräften (HCPs) – Allgemeinmedizinern, Kardiologen und Pflegekräften – hinsichtlich der Vorteile und Hindernisse bei der Integration von mobilen Gesundheitsanwendungen (mHealth-Apps) in die routine mäßige Behandlung von Hypertonie. Durch qualitative, halbstrukturierte Interviews zwischen Oktober 2022 und März 2023 wurden drei Hauptthemen identifiziert: mHealth-Apps können die Patientensicherheit durch kontinuierliche Überwachung erhöhen, die Autonomie der Patienten fördern und die medizinische Versorgung durch Echtzeitdaten unterstützen. Dennoch wurden Barrieren wie Datenmanagement, Kommunikationsprobleme und Systemhandling hervorgehoben, die strukturelle und prozedurale Anpassungen erfordern. Die Studie betont, dass eine erfolgreiche Nutzung digitaler Tools die Überwindung von Hindernissen wie Interoperabilitätsproblemen, unklaren Kostenerstattungsrichtlinien und Informationsbedarf erfordert, während die Einbindung der Nutzer und verständliche Informationen entscheidend für die Akzeptanz und Verbreitung von mHealth-Apps in der Hypertoniebehandlung sind. (May u. a. 2025)
Die Studie „Design and Implementation of an Electronic Health Record-Integrated Hypertension Management Application“ beschreibt die Entwicklung einer digitalen Plattform zur Blutdruckkontrolle. Diese richtet sich an Kliniker und integriert evidenzbasierte Algorithmen, um die Inaktivität von Ärzten zu verringern und die Hypertoniebehandlung zu verbessern. Die Entwicklung umfasste Bedarfsanalysen, Workflow-Analysen, die Erstellung eines Behandlungsalgorithmus und die Integration in elektronische Patientenakten. Tests in fünf Kliniken zeigten eine durchschnittliche Senkung des systolischen Blutdrucks um 14,4 mmHg. Die Plattform zielt darauf ab, die klinische Arbeitsbelastung zu reduzieren und die Blutdruckkontrolle durch nahtlose EHR-Integration und automatisierte Medikamentenempfehlungen zu optimieren. (Funes Hernandez u. a. 2024)
Sekundärprävention
Die TIMELY-Studie der Universität Witten/Herdecke (https://www.uni-wh.de/timely-studie) entwickelt eine patientenzentrierte eHealth-Plattform, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) die Sekundärprävention bei koronarer Herzkrankheit (KHK) verbessert. Sie nutzt Geräte wie Blutdruckmessgeräte, EKG-Pflaster und Activity Tracker, um Risiken kontinuierlich zu überwachen, und setzt KI-Chatbots ein, um den psychischen Zustand der Patienten zu bewerten und gezielte Verhaltensinterventionen anzubieten. Ziel ist es, die Selbstfürsorge der Patienten sowie die Effizienz der Kliniker zu steigern, indem Risikofaktoren und Symptome besser gemanagt werden. Die Plattform wird in einer multizentrischen, randomisierten Studie in Deutschland, den Niederlanden und Spanien evaluiert, um ihre Wirksamkeit und Kosteneffizienz zu prüfen.
Die Studie “Gesundheitsfachkräfte und digitale Technologien in der Sekundärprävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Österreich: Online-Umfragestudie” zeigt, dass Gesundheitsfachkräfte in Österreich großes Interesse an digitalen Technologien für die Sekundärprävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, jedoch nur 52 % diese aktiv nutzen. Hauptbarrieren sind schlechte Benutzerfreundlichkeit, fehlende Kostenerstattung und geringe digitale Kompetenz der Patienten. Als potenzielle Anwendungsbereiche wurden Terminplanung, Dokumentation und personalisierte Behandlungspläne hervorgehoben. Fördernde Faktoren sind Patientensicherheit, Datenschutz und technische Unterstützung. Jüngere Fachkräfte mit höherer Technologieaffinität zeigen eine größere Bereitschaft zur Nutzung digitaler Technologien. Die Ergebnisse können zukünftige Digitalisierungsprojekte unterstützen, indem sie bestehende Hindernisse adressieren. (Lunz, Würth, und Kulnik 2025)
Patientenselbstmanagement
Die Studie „Patient-Reported Experiences With Long-Term Lifestyle Self-Monitoring in Heart Disease: Mixed Methods Study“ untersuchte Erfahrungen von Patienten mit einem digitalen Selbstmonitoring-System, das eine Webanwendung, eine Gesundheitsuhr und einen Chatbot zur langfristigen Überwachung von Lebensstilfaktoren nach kardialen Eingriffen kombiniert. In der einjährigen Studie mit 100 Patienten zeigte sich, dass 57% das System vollständig nutzten, während 43% aus verschiedenen Gründen ausstiegen, darunter hoher Aufwand beim Selbstbericht, technische Probleme und psychische Belastung. Die Teilnehmer, die das System beibehielten, berichteten von gesteigerter Bewusstheit für ihre Lebensstilfaktoren, insbesondere körperliche Aktivität und Ernährung, sowie von Verhaltensänderungen. Die Autoren betonen, dass eine personalisierte, flexible Gestaltung und Minimierung der Nutzlast entscheidend sind, um langfristige Engagements zu fördern und digitale Gesundheitslösungen im kardiologischen Kontext zu optimieren. (Goevaerts u. a. 2025)
Herzgesundheit
Die Arbeit “Mobile Apps and Wearable Devices for Cardiovascular Health: Narrative Review” von Gauri Kumari Chauhan, Patrick Vavken und Christine Jacob untersucht den aktuellen Stand von mobilen Gesundheitsanwendungen (mHealth-Apps) und tragbaren Geräten (Wearables) zur Förderung der Herzgesundheit, mit einem besonderen Fokus auf die DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz). Ziel der narrativen Übersicht ist es, die Vorteile dieser Technologien für Patienten und Kliniker zu bewerten, insbesondere hinsichtlich ungedeckter Bedürfnisse wie geschlechtsspezifischer Symptome, sowie deren Integration in das Gesundheitssystem zu analysieren. Mithilfe einer Suche in den Schweizer App-Stores und auf Google wurden 20 Apps und 22 Wearables identifiziert und anhand eines soziotechnischen Rahmens bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass nur wenige Apps (30 %) und Wearables (9 %) speziell für die DACH-Region entwickelt wurden, geschlechtsspezifische Informationen oft fehlen (25 % der Apps, 40 % der Wearables) und die klinische Integration begrenzt ist. Während Wearables häufiger evidenzbasiert und medizinisch zertifiziert sind, mangelt es vielen Apps an wissenschaftlicher Grundlage, was ihr Potenzial einschränkt. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, diese Technologien inklusiver und besser in klinische Abläufe integrierbar zu gestalten, um die Herzgesundheit effektiv zu verbessern. (Chauhan, Vavken, und Jacob 2025)
Entlassungsbriefe
Die Studie “Evaluation of a large language model to simplify discharge summaries and provide cardiological lifestyle recommendations”, veröffentlicht in Communications Medicine im Mai 2025, untersucht die Nutzung eines großen Sprachmodells (LLM), GPT-4o, zur Vereinfachung von kardiologischen Entlassungsberichten und zur Erstellung von Lebensstilempfehlungen. 20 anonymisierte Berichte wurden mit zwei Ansätzen (volltext- und segmentweise) verarbeitet, um die Lesbarkeit zu verbessern und personalisierte Empfehlungen zu generieren. Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der Lesbarkeit (10. Schulstufe), wobei die Berichte korrekt, vollständig, harmlos und patientenverständlich waren, laut Bewertung von 12 medizinischen Experten. Die Lebensstilempfehlungen waren relevant und evidenzbasiert, jedoch nur begrenzt personalisiert. Die Studie deutet auf das Potenzial von LLMs für patientenzentrierte Berichte hin, erfordert aber weitere Forschung zu klinischer Anwendung, Qualitätssicherung und Datenschutz. (Rust u. a. 2025)
Kardiale Bildgebung
Die Studie „CT coronary angiography with HeartFlow®: a user’s perspective“ untersucht die Rolle der Computertomographie-Koronarangiographie (CTCA) in Kombination mit der HeartFlow®-Technologie zur Beurteilung von koronaren Herzerkrankungen. Seit der Aktualisierung der NICE-Richtlinie (CG95) im November 2016 ist CTCA die bevorzugte Erstuntersuchung bei Verdacht auf Angina pectoris, da sie eine hohe Sensitivität (89 %) beim Ausschluss obstruktiver Koronararterienerkrankungen (CAD) bietet, jedoch mit einer niedrigeren positiven prädiktiven Wert von 48 %. HeartFlow® nutzt fortschrittliche computergestützte Strömungsdynamik, um die fraktionelle Flussreserve (FFRCT) aus CTCA-Daten zu berechnen, was die funktionelle Bedeutung von Stenosen präzise bestimmen kann. Studien wie PLATFORM und ADVANCE zeigen, dass CTCA mit FFRCT zu vergleichbaren klinischen Ergebnissen führt wie herkömmliche Tests, bei potenziellen Kosteneinsparungen von mindestens 9,1 Millionen Pfund bis 2022 im NHS. (Brady u. a. 2019)
Echokardiographie
Der Artikel „Complete AI-Enabled Echocardiography Interpretation With Multitask Deep Learning“ stellt PanEcho vor, ein KI-System zur automatisierten Echokardiogramm-Auswertung. Es nutzt tiefes Lernen, um 39 diagnostische Aufgaben präzise zu bewältigen. PanEcho erreicht eine mediane AUC von 0,91 für Klassifikationsaufgaben und einen normalisierten MAE von 0,13 für Schätzungen. Das System ist vielseitig einsetzbar, sowohl in Echokardiographie-Laboren als auch in der Point-of-Care-Diagnostik. Es wurde international validiert und ist open-source verfügbar. PanEcho könnte die kardiovaskuläre Diagnostik effizienter und zugänglicher machen. (Holste u. a. 2025)
Forschungsplattformen
Die BigData@Heart-Initiative, gestartet im März 2017, ist ein fünfjähriges Projekt der Innovative Medicines Initiative (IMI), einem öffentlich-privaten EU-Konsortium aus Patientennetzwerken, Fachgesellschaften, KMUs, Pharmaunternehmen und akademischen Einrichtungen. In Zusammenarbeit mit der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) und europäischen Forschungspartnern entwickelt BigData@Heart eine big-data-gestützte translationale Forschungsplattform. Sie nutzt umfangreiche europäische Datenbanken, darunter elektronische Patientenakten, Krankheitsregister und klinische Studien mit über fünf Millionen Patienten mit akutem Koronarsyndrom, Vorhofflimmern und Herzinsuffizienz. Ziel ist es, durch harmonisierte Datensätze und Algorithmen Krankheitsverläufe vorherzusagen, Forschungsstandards für heterogene Daten zu setzen und ethische sowie rechtliche Aspekte der Datennutzung zu klären. Die CODE-EHR-Publikation bietet einen Rahmen zur Verbesserung der Qualität und Transparenz von Studien mit Gesundheitsdaten.
IoT & VHF
Die Studie „Screening for Atrial Fibrillation in Older Adults at Primary Care Visits: VITAL-AF Randomized Controlled Trial“ untersuchte, ob ein Screening auf Vorhofflimmern (AF) mittels eines tragbaren Ein-Kanal-EKGs (AliveCor KardiaMobile) während Routineuntersuchungen in hausärztlichen Praxen die Häufigkeit von neu diagnostiziertem AF bei Personen ab 65 Jahren erhöhen kann. In 16 Praxen wurden rund 30.000 Patient:innen in eine Screening- oder Kontrollgruppe randomisiert. Nach einem Jahr zeigte sich insgesamt kein signifikanter Unterschied in der Rate neu diagnostizierten AF zwischen Screening und Standardversorgung, jedoch wurden in der Subgruppe der über 85-Jährigen mehr Fälle entdeckt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass routinemäßiges Screening in der Primärversorgung nur begrenzt zusätzlichen Nutzen bringt, aber in besonders hochbetagten Patientengruppen relevanter sein könnte. (Lubitz u. a. 2022)
Weiteres
Die Studie „Factors associated with physician modifications to automated ECG interpretations“ untersuchte retrospektiv 159.630 EKG-Berichte aus den Jahren 2011 bis 2023 am Cedars-Sinai Medical Center. Dabei wurden automatisierte Vorberichte des GE Marquette™ 12SL-Programms mit den finalisierten ärztlichen Berichten verglichen. In 31,3 % der Fälle nahmen Ärzte textuelle Änderungen vor. Modifikationen traten häufiger bei EKGs außerhalb der Regelarbeitszeiten, bei höheren Ventrikelraten und längeren QRS-Dauern auf. Häufig hinzugefügt wurden Diagnosen wie „prolonged QT interval“ (5,6 % der ursprünglich fehlenden Berichte) und „electronic ventricular pacemaker“ (3,6 %), während „inferior infarct“ und „anterior infarct“ oft entfernt wurden (32,0 % bzw. 44,6 % der automatisierten Berichte). Die Analyse zeigt Grenzen regelbasierter Systeme bei komplexen Befunden.
Die Studie „TAILORED CARDIAC ABLATION PROCEDURE FOR PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION GUIDED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE TAILORED-AF RANDOMIZED CLINICAL TRIAL“ wurde in der Zeitschrift Heart Rhythm (Volume 21, Issue 7, Juli 2024, Seite 1199) veröffentlicht. Sie untersuchte in einer prospektiven, randomisierten, multizentrischen Studie an 26 Zentren in Europa und den USA, ob eine KI-gestützte, individuell angepasste Ablationsstrategie (PVI plus Ablation von Bereichen mit spatiotemporaler Dispersion) bei Patienten mit persistierendem und langanhaltendem Vorhofflimmern einer reinen pulmonalvenen-isolierenden Ablation (PVI-only) überlegen ist. In der Interim-Analyse (n=146) zeigte die Tailored-Gruppe signifikant höhere Raten an akutem AF-Terminationserfolg (78 % vs. 10 %, p<0,001) und Freiheit von Vorhofflimmern nach 12 Monaten (89 % vs. 67 %, p=0,001). Die Schlussfolgerung lautet, dass die KI-gestützte, individuell angepasste Ablation bei persistierendem Vorhofflimmern der Standard-PVI-Strategie überlegen ist.
Die Studie „AI-Assisted Cardiovascular Risk Assessment by General Practitioners in Resource-Constrained Indonesian Settings Using a Conceptual Prototype: Randomized Controlled Study“ wurde am 25. November 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol 27, e73131) veröffentlicht. In einer randomisierten kontrollierten Untersuchung mit 102 indonesischen Allgemeinmedizinern und Kardiologie-Assistenten wurde der Einsatz eines konzeptionellen KI-basierten klinischen Entscheidungsunterstützungssystems (CDS) im Vergleich zu automatisierter CDS und keiner Unterstützung getestet. Anhand von neun klinischen Vignetten zeigte die KI-Unterstützung eine signifikante Verbesserung der korrekten 10-Jahres-ASCVD-Risikoeinschätzung um 27 % sowie der Statin-Verschreibung um 29 %, bei gleichzeitiger Verkürzung der Entscheidungszeit. Die Verschreibung von Aspirin und Antihypertensiva sowie Verweisentscheidungen verbesserten sich nicht signifikant. Die teilnehmenden Ärzte bewerteten das KI-CDS überwiegend positiv und würden es in der Praxis nutzen. Die Ergebnisse unterstreichen das Potenzial KI-gestützter Entscheidungshilfen zur Verbesserung der kardiovaskulären Primärprävention in ressourcenarmen Settings.
Der Artikel „A Foundation Transformer Model with Self-Supervised Learning for ECG-Based Assessment of Cardiac and Coronary Function“ beschreibt die Entwicklung eines selbstüberwachten Foundation-Modells auf Basis eines modifizierten Vision Transformers für die EKG-basierte Bewertung kardialer und koronarer Funktionen. Das Modell wurde auf einer großen Datenbank ungelabelter EKG-Wellenformen (MIMIC-IV-ECG, N=800.035) vortrainiert und anschließend auf kleineren gelabelten Datensätzen feinabgestimmt. Es erreichte hohe diagnostische Genauigkeiten in verschiedenen Aufgaben, mit AUROC-Werten von 0,763 bis 0,955, und zeigte verbesserte Leistung sowie Generalisierbarkeit durch Self-Supervised Learning im Vergleich zu rein überwachtem Training. Das Modell unterstützt insbesondere die Erkennung von Myokardischämie und koronarer Mikrovaskulärer Dysfunktion bei begrenzter Verfügbarkeit hochwertiger Labels.
Die Studie mit dem Titel „Physical Activity Recommendations Tailored by a Predictive Model for Adults With High Blood Pressure: Observational Study“ wurde am 9. Januar 2026 im Journal of Medical Internet Research veröffentlicht. Sie untersucht anhand von Daten aus der UK Biobank (71.637 Teilnehmer) und der NHANES-Kohorte (5.104 Teilnehmer), ob individuelle Merkmale die Zusammenhänge zwischen verschiedenen körperlichen Aktivitätsmustern und der Gesamtmortalität bei Erwachsenen mit erhöhtem Blutdruck modifizieren. Mithilfe eines maschinellen Lernmodells (S-learner-Ansatz) wurden vier Aktivitätsmuster – active weekend warrior, active regular, active light PA und baseline PA – analysiert und ein prädiktives Modell entwickelt, das das optimale Muster für jeden Einzelnen vorhersagt. Das Modell zeigte in der externen Validierung eine gute Diskriminationsfähigkeit (AUC 86,4 % für die 10-Jahres-Mortalitätsvorhersage). Personen, deren aktuelles Aktivitätsmuster nicht mit dem vorhergesagten optimalen Muster übereinstimmte, wiesen im Durchschnitt ein um 28 % erhöhtes Mortalitätsrisiko auf (HR 1,28). Entscheidend für die Heterogenität der optimalen Muster waren vor allem Schlaganfallanamnese, Alter, Geschlecht, Blutdruckklasse und die Einnahme von Antihypertensiva. Die Ergebnisse wurden in eine webbasierte Anwendung integriert, um individualisierte Bewegungsempfehlungen für Hypertoniepatienten zu ermöglichen und deren Prognose potenziell zu verbessern.
„A Deep Learning Model to Identify Mitral Valve Prolapse From the Echocardiogram“ ist eine Originalarbeit, die im Jahr 2025 in JACC: Cardiovascular Imaging (Volume 19, Number 1) erschienen ist. Die Studie stellt das Deep-Learning-Modell DROID-MVP vor, das aus transthorakalen Echokardiographie-Videos eine Mitralklappenprolaps (MVP) automatisch klassifiziert. Das Modell wurde mit über einer Million Echovideos von mehr als 16.000 kardiologischen Patienten am Massachusetts General Hospital trainiert und in internen sowie externen Kohorten (einschließlich Primary-Care-Patienten an MGH und BWH) validiert. Es erreichte dabei hohe diagnostische Genauigkeit (AUROC-Werte zwischen 0,947 und 0,968). Darüber hinaus zeigten die Modellvorhersagen signifikante Assoziationen mit dem Schweregrad der Mitralinsuffizienz sowie mit dem zukünftigen Bedarf an einem Mitralklappenersatz. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Deep Learning die MVP-Diagnostik automatisieren und potenziell klinisch relevante digitale Marker generieren kann.
„Comparative Evaluation of Consumer Wearable Devices for Atrial Fibrillation Detection: Validation Study“ ist eine im Januar 2025 in JMIR Formative Research veröffentlichte prospektive Validierungsstudie. In der Untersuchung wurden bei 122 kardiologischen Patienten vier consumer-orientierte Wearables – KardiaMobile 6L (6-Kanal-ECG), Apple Watch (1-Kanal-ECG), FibriCheck und Preventicus (beide PPG-basiert über Smartphone) – hinsichtlich ihrer Fähigkeit verglichen, zwischen Sinusrhythmus und Vorhofflimmern (AF) zu unterscheiden, wobei ein simultanes 12-Kanal-ECG als Goldstandard diente. Alle vier Geräte erreichten eine Sensitivität von 100 % zur Detektion von AF; die Spezifität zur korrekten Identifikation des Sinusrhythmus lag zwischen 96,4 % (KardiaMobile) und 98,9 % (FibriCheck) ohne statistisch signifikante Unterschiede. Die Rate unzureichender Messqualität bewegte sich zwischen 7,4 % und 14,8 %, war jedoch ebenfalls nicht signifikant unterschiedlich. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die geprüften consumer Wearables in dieser Population eine sehr hohe und vergleichbare diagnostische Genauigkeit bei der Unterscheidung von Sinusrhythmus und Vorhofflimmern aufweisen.
Der Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit und stellt keine Rechtsberatung dar. Anmerkungen können in der rechten Seitenleiste mit Hypothes.is sozialem Annotierungswerkzeug oder am unteren Ende einer Seite mit GitHub Giscus Diskussionen hinterlassen werden.