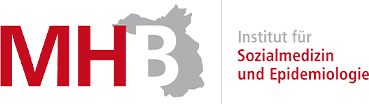Digitale Versorgungsprozesse
Forschung
Die Studie „The impact of a combinatorial digital and organisational intervention on the management of long-term conditions in UK primary care: a non-randomised evaluation“ untersucht die Auswirkungen einer kombinierten digitalen und organisatorischen Intervention auf die Behandlung chronischer Erkrankungen in der britischen Grundversorgung. Diese Intervention, die im Rahmen des NHS Test Beds-Programms 2016 in einer Gesundheitsregion in Nordwestengland umgesetzt wurde, kombinierte Risikostratifizierungsalgorithmen, praxisbasierte Qualitätsverbesserungen sowie Telemonitoring und Gesundheitscoaching, um die Versorgung von Patienten mit chronischen Erkrankungen wie COPD, Typ-2-Diabetes und Herzinsuffizienz zu verbessern. Die Evaluierung nutzte administrative Daten aus Krankenhaus- und Primärversorgung und verglich diese mit einer Kontrollregion mittels Differenz-in-Differenz-Analyse. Die Ergebnisse zeigen keinen signifikanten positiven Einfluss auf die primären Zielgrößen wie Krankenhausnutzung, lediglich ein sekundäres Ergebnis wies eine statistisch signifikante Veränderung auf. Die Autoren schließen, dass die Intervention trotz flächendeckender Implementierung keine Verbesserung der Versorgungsergebnisse erzielte, was möglicherweise auf Implementierungsschwierigkeiten zurückzuführen ist. (Lugo-Palacios u. a. 2019)
Die Studie „Impact of digital services on healthcare and social welfare: An umbrella review“ untersucht den Einfluss digitaler Dienstleistungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, Kosten, Zufriedenheit von Patienten und Gesundheitsfachkräften sowie fördernde und hemmende Faktoren bei deren Nutzung. Die Untersuchung, die 66 systematische Übersichtsarbeiten umfasst, zeigt, dass digitale Dienste wie Telemedizin und mobile Gesundheitsanwendungen gemischte Auswirkungen auf Gesundheit und Kosten haben, aber eine hohe Patientenzufriedenheit erzielen. Die Zufriedenheit von Fachkräften ist weniger untersucht und zeigt gemischte Ergebnisse. Fördernde Faktoren umfassen benutzerfreundliche Schnittstellen und organisatorische Unterstützung, während technische Probleme, mangelnde digitale Kompetenz und fehlende Finanzierungsstrategien die Nutzung behindern. Weitere Forschung ist notwendig, um langfristige Effekte und die Anwendung im Sozialwesen zu bewerten. (Härkönen u. a. 2024)
Hospital-at-Home
Die Studie “Collaborative development of a rules-based electronic health record algorithm for Hospital-at-Home eligibility” befasst sich mit der Entwicklung eines regelbasierten Algorithmus (RBA), der auf elektronischen Gesundheitsakten basiert, um die Eignung von Patient:innen für das „Hospital-at-Home“-Modell (HaH) effizienter zu bestimmen. Ziel war es, durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Einbindung klinischer Rückmeldungen einen praxisnahen Algorithmus zu entwickeln, der die Auswahl geeigneter Patient:innen verbessert und klinische Abläufe unterstützt. Die Forschung zeigt, wie datenbasierte Ansätze zur Optimierung neuartiger Versorgungsmodelle beitragen können. (T.-L. Liu u. a., o. J.)
Das Projekt Stay@Home – Treat@Home (STH) der Charité – Universitätsmedizin Berlin entwickelt ein telemedizinisch unterstütztes, transsektorales Kooperationsnetzwerk, um ambulante Pflegebedürftige in Berlin rund um die Uhr zu versorgen. Ziel ist die frühzeitige Erkennung und Kommunikation gesundheitlicher Verschlechterungen, um frühzeitig im häuslichen Umfeld zu intervenieren, ungeplante Krankenhausaufenthalte zu vermeiden und die Lebensqualität zu verbessern. Unterstützt durch ein digitales Gesundheitstagebuch (DiG) und in Kooperation mit der Zentralen Notaufnahme, werden 1.500 Pflegebedürftige eingebunden. Das Projekt, gefördert vom Innovationsfonds, läuft von Oktober 2022 bis September 2026.
Die Studie „Comparison of Hospital-at-Home models: a systematic review of reviews“ von Leong MQ et al., veröffentlicht in BMJ Open 2021, untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit von Hospital-at-Home (HaH)-Modellen, aufgeteilt in Early-Supported Discharge (ESD) und Admission Avoidance (AA). Die systematische Überprüfung von Reviews analysiert klinische Ergebnisse, Krankenhausaufenthaltsdauer (LOS) und Kosten. Die Ergebnisse zeigen, dass HaH im Vergleich zur stationären Behandlung ähnliche oder bessere klinische Ergebnisse erzielt, die Krankenhausaufenthaltsdauer verkürzt und die Patientenzufriedenheit hoch ist. AA-Modelle zeigen tendenziell bessere Ergebnisse bei Mortalität, Wiedereinweisungen und Kosten im Vergleich zu ESD. Die Studie empfiehlt, AA-Modelle zu priorisieren, weist jedoch auf die Notwendigkeit weiterer Forschung zu Kosten, Pflegebelastung und unerwünschten Ereignissen hin. (Leong, Lim, und Lai 2021)
Stand & Land
Die Studie „Superior medical resources or geographic proximity? The joint effects of regional medical resource disparity, geographic distance, and cultural differences on online medical consultation“ untersucht die Auswirkungen regionaler Unterschiede in der Verfügbarkeit medizinischer Ressourcen, geografischer Distanz und kultureller Unterschiede auf Online-Konsultationen zwischen Patienten und Ärzten. Basierend auf 813.684 Konsultationsdatensätzen zeigt die Studie, dass Patienten aus medizinisch benachteiligten Regionen vermehrt Ärzte aus Regionen mit besseren medizinischen Ressourcen konsultieren. Geografische Distanz und kulturelle Unterschiede wirken jedoch einschränkend auf diese Konsultationen, wobei die Distanz den Einfluss medizinischer Ressourcenunterschiede abschwächt, während kulturelle Unterschiede diesen verstärken. Die Online-zu-Offline-Natur der Konsultationen trägt zur Einschränkung durch geografische Distanz bei, während Ärztereputation und Plattformbeteiligung diese Effekte mildern können. Die Ergebnisse bieten Implikationen für die Verteilung medizinischer Ressourcen und die Gestaltung von Gesundheitspolitik. (X. Liu und Liu 2024)
Die Studie „The digital divide in rural and regional communities: a survey on the use of digital health technology and implications for supporting technology use“ untersucht die digitale Gesundheitskompetenz und das Engagement von Menschen in ländlichen und regionalen Gemeinschaften. Ziel war es, Barrieren und Förderfaktoren für die Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien zu identifizieren. An der Umfrage nahmen 40 Erwachsene teil, die mindestens eine digitale Gesundheitstechnologie verwendet hatten. Die meisten (80 %) zeigten mit einem eHEALS-Score von 26 oder höher Vertrauen in Online-Gesundheitsinformationen. Häufige Hindernisse waren Produktkomplexität, mangelnde Zuverlässigkeit, fehlende Kenntnis von Ressourcen, Misstrauen und Kosten. Die Studie betont die Notwendigkeit, Personen mit geringerer digitaler Gesundheitskompetenz gezielt zu unterstützen, um den Zugang zu und die Nutzung von digitalen Gesundheitstechnologien zu verbessern. (Jongebloed u. a. 2024)
Der Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit und stellt keine Rechtsberatung dar. Anmerkungen können in der rechten Seitenleiste mit Hypothes.is sozialem Annotierungswerkzeug oder am unteren Ende einer Seite mit GitHub Giscus Diskussionen hinterlassen werden.