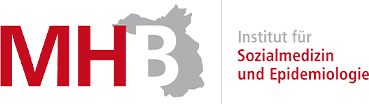Digitale Kompetenz
Die digitale Transformation im Gesundheitswesen erfordert von Gesundheitsberufen nicht nur MINT-Kompetenzen wie IT-Literacy und Datenmanagement, sondern auch spezifische Fähigkeiten wie digitale Kommunikation, ethisch-rechtliche Kenntnisse, patientenzentrierte Technologienutzung und sichere Integration digitaler Lösungen in die Versorgung, wie in den Studien „A Digitally Competent Health Workforce“ und „Healthcare Professionals’ Competence in Digitalisation“ beschrieben. Zusätzlich sind Kenntnisse in elektronischen Gesundheitsakten, Telemedizin, KI und Datenschutz sowie soziale und adaptive Kompetenzen essenziell, wie in „The Digital Health Competencies in Medical Education Framework“ und „Enhancing Digital Readiness and Capability in Healthcare“ betont. Die Anforderungen sind breiter und domänenspezifischer als reine MINT-Fähigkeiten, wie „Understanding the Gap“ und „Digital Health Competencies Among Health Care Professionals“ zeigen. [N. Nazeha u. a. (2020);Konttila u. a. (2019);J. Car u. a. (2025);sumner2025understanding;Longhini, Rossettini, und Palese (2022);Alotaibi, Wilson, und Traynor (2025)]
Ausbildung für das digitale Gesundheitssystem
In einer Studie stellen Car et al. das DECODE-Framework vor, ein international konsensbasiertes Modell für digitale Gesundheitskompetenzen in der medizinischen Ausbildung. Aufgrund der schnellen Digitalisierung im Gesundheitswesen und eines Mangels an entsprechender Ausbildung wurde ein strukturiertes Kompetenzmodell entwickelt. In einer Delphi-Studie mit 211 Experten aus 79 Ländern wurden vier Hauptbereiche identifiziert: Professionalität in der digitalen Gesundheit, Patienten- und Bevölkerungsbezogene digitale Gesundheit, Gesundheitsinformationssysteme und Gesundheitsdatenwissenschaft. Diese umfassen 19 Kompetenzen mit insgesamt 33 obligatorischen und 145 fakultativen Lernzielen. Das Framework soll medizinischen Fakultäten helfen, digitale Gesundheit systematisch in ihre Lehrpläne zu integrieren, um zukünftige Ärzte besser auf technologische Entwicklungen vorzubereiten. (Josip Car, Ong, Erlikh Fox, Leightley, u. a. 2025)
In einem ergänzenden Kommentar werden die Unsicherheiten in der digitalen Transformation der medizinischen Ausbildung, insbesondere im Kontext von Künstlicher Intelligenz (KI) und digitalen Gesundheitstechnologien diskutiert. Das internationale DECODE-Rahmenwerk definiert Kompetenzen und zahlreiche Lernziele, um Medizinstudenten auf zukünftige digitale Herausforderungen vorzubereiten. Neben technischen Fähigkeiten betont der Artikel die Notwendigkeit, Patienten als Mitgestalter ihrer eigenen Versorgung einzubinden. Wichtige Themen sind die Bewertung und Nutzung digitaler Werkzeuge, der Umgang mit Bias in Algorithmen und die ethische Verantwortung im Einsatz von KI. Zudem wird empfohlen, Studierende praxisnah mit Fallstudien und Simulationen auf die datengetriebene Patientenkommunikation vorzubereiten, um eine informierte und vertrauensvolle Arzt-Patient-Beziehung zu fördern. (Liebovitz 2025)
Das Projekt „Neue Gesundheitsberufe für das digitale Zeitalter“ der Stiftung Münch, veröffentlicht im Februar 2020, schlägt vor, die Ausbildung im Gesundheitswesen angesichts der digitalen Transformation und demografischer Herausforderungen grundlegend zu reformieren. Die Reformkommission plädiert für die Einführung dreier neuer Berufe: Fachkraft für digitale Gesundheit, Prozessmanager für digitale Gesundheit und Systemarchitekt für digitale Gesundheit. Diese Berufe sollen durch spezifische Kompetenzen und innovative Curricula die Versorgung verbessern, digitale Technologien wie KI und Telemedizin integrieren und die interprofessionelle Zusammenarbeit fördern. Ziel ist es, die Qualität der Gesundheitsversorgung zu steigern, insbesondere für chronisch Kranke, und die Berufsbilder an die Anforderungen eines digitalisierten Gesundheitssystems anzupassen. (Kuhn u. a. 2020)
Die Masterarbeit “Erfassung und Förderung digitaler Kompetenzen von Hochschullehrenden der Humanmedizin” untersucht die digitalen Kompetenzen von Hochschullehrenden der Humanmedizin in Deutschland mittels einer Mixed-Methods-Studie, basierend auf dem „Digital Competence Framework for Educators“ (DigCompEdu) und dem „Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin“ (NKLM). Eine Online-Umfrage mit 432 Lehrenden und sechs Experteninterviews zeigen, dass die digitalen Kompetenzen der Lehrenden ein breites Spektrum abdecken, wobei sie ihre lehr- und medizinspezifischen Kompetenzen auf mittlerem Niveau einschätzen, während Experten diese als schwach bis mittel bewerten. Zur Förderung werden praxisnahe, fachspezifische Qualifizierungsmaßnahmen und institutionelle Unterstützung empfohlen, um digitale Technologien effektiv in die Lehre zu integrieren. (Körner 2024)
Die Studie „Organizational e-Health Readiness: How to Prepare the Primary Healthcare Providers’ Services for Digital Transformation“ untersucht die organisatorische Bereitschaft polnischer Grundversorgungseinrichtungen für die digitale Transformation. Sie entwickelt und bewertet ein Modell der organisatorischen E-Health-Bereitschaft (OeHR) mit fünf Dimensionen – strategisch, kompetenzbezogen, kulturell, strukturell und technologisch – basierend auf einer Literaturübersicht, einer Umfrage unter 371 Managern und der PLS-SEM-Methode. Die Ergebnisse zeigen, dass das Modell für reife Organisationen geeignet ist, die auf patienten- und mitarbeiterorientierte Digitalisierung und kontinuierliche Pflegeprozesse fokussiert sind, während in Krisenzeiten wie der COVID-19-Pandemie ein vereinfachtes Modell die Bereitschaft besser abbildet. (Kruszyńska-Fischbach u. a. 2022)
Der Wissenstransfer digitaler Fähigkeiten in Arztpraxen gelingt am besten durch multimodale, interaktive Lernmethoden wie Präsenzschulungen, E-Learning, Blended-Learning, Fallstudien, Simulationen und Peer-Learning. Peer-Ansätze wie Peer-Assisted Learning fördern Motivation, Selbstvertrauen und Praxistransfer. Lotsen und Navigatoren spielen eine zentrale Rolle, indem sie Lernprozesse moderieren, digitale Tools an Praxisbedürfnisse anpassen und als Bindeglied zwischen Technologie und Teams agieren. Ein Mix aus bottom-up- und top-down-Ansätzen steigert die Akzeptanz und Nachhaltigkeit, wobei individuelle Lernbedarfe und informelle Netzwerke die Effektivität erhöhen. [Kulju u. a. (2024);Navarro Martínez, Igual García, und Traver Salcedo (2022);Vijayan u. a. (2025);Chan, Botelho, und Wong (2021);Grol (2001);J. Car u. a. (2025);Alon u. a. (2024);Cresswell u. a. (2021);@]
Die Studie „Digital Literacy Training for Digitalization Officers (“Digi-Managers”) in Outpatient Medical and Psychotherapeutic Care: Conceptualization and Longitudinal Evaluation of a Certificate Course“ untersucht die Entwicklung und Evaluation eines Zertifikatskurses für Medizinische Fachangestellte, die als Digitalisierungsbeauftragte („Digi-Manager“) in ambulanten medizinischen und psychotherapeutischen Praxen fungieren. Ziel des Kurses war es, digitale Kompetenzen zu vermitteln, um Digitalisierungsstrategien umzusetzen und als Ansprechperson für digitale Prozesse zu dienen. Die begleitende Studie bewertete die Kursteilnahme und maß die digitale Kompetenz der Teilnehmenden zu drei Zeitpunkten (vor, während und nach dem Kurs) mittels ANOVA. Die Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen in kognitiven, technischen, ethischen und gesundheitsinformationsbezogenen Kompetenzen sowie im Selbstvertrauen beim Umgang mit Technologie, während die positive Einstellung stabil blieb. Der Kurs wurde von den Teilnehmenden durchweg positiv bewertet, insbesondere die praktische Anwendung durch ein digitales Reifegradmodell und ein digitales Labor. Die Studie betont die Notwendigkeit solcher Schulungsprogramme und schlägt weitere Forschung zu alternativen Bewertungsmethoden für digitale Kompetenzen vor. (Mainz u. a. 2025)
Die Studie “The Role of Physicians in Digitalizing Health Care Provision: Web-Based Survey Study” untersucht die Rolle von Ärzten bei der Digitalisierung der Gesundheitsversorgung in Deutschland und den Einfluss des Alters. Eine groß angelegte Online-Umfrage mit 1274 Teilnehmern zeigte eine hohe Affinität zur Digitalisierung (Durchschnitt 3,88 auf einer 5-Punkte-Likert-Skala), wobei jüngere Ärzte eine stärkere Neigung zu digitalen Technologien aufweisen. Die Teilnehmer nutzen bereits digitale Tools, insbesondere für Datenqualität (69,23 %), sehen jedoch noch ungenutztes Potenzial, vor allem in der medizinischen Wissensvermittlung (89,17 %). Ärzte beschreiben ihre Rolle als ambivalent – „prüfend“, aber auch „aktiv“ und „offen“. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit einer besseren Ausbildung in digitaler Kompetenz, um die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben. (Burmann u. a. 2021)
Die Studie „Telehealth Acceptance and Perceived Barriers Among Health Professionals: Pre-Post Evaluation of a Web-Based Telehealth Course“ untersucht den Einfluss eines webbasierten Telehealth-Kurses auf die Akzeptanz und wahrgenommenen Barrieren bei Gesundheitsfachkräften in Österreich. In einem interventiven Pre-Post-Design nahmen 365 Gesundheitsprofis an einem asynchronen Online-Kurs teil, der allgemeine Telehealth-Grundlagen (Koncepte, rechtliche und technische Aspekte, praktische Umsetzung) sowie berufsspezifische Inhalte für Bereiche wie Pflege, Logopädie und Physiotherapie umfasste. Von den 217 Kursabsolventen erfüllten 185 die Einschlusskriterien; die Akzeptanz von Telehealth (einschließlich Telemetrie, Telephasia und Telepraxis) und Barrieren wie rechtliche Unsicherheiten, Datenschutz und Qualitätsminderung wurden mittels standardisierter Fragebögen vor und nach dem Kurs gemessen. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Steigerung der Gesamtakzeptanz (P < .001, r = 0.21), insbesondere bei Telemetrie, Telepraxis und videobasierten sowie asynchronen Formen, sowie eine deutliche Reduktion der Barrieren (P < .001, r = 0.39). Die Kurszufriedenheit war hoch (medianer Training Evaluation Inventory-Score: 76), wobei qualitative Rückmeldungen aus Umfragen und Fokusgruppen mehr praktische Demonstrationen und interaktive Elemente forderten. Die Studie schließt, dass solch ein strukturierter On-Demand-Kurs das Bewusstsein und die Bereitschaft zur Nutzung von Telehealth steigert, empfiehlt jedoch blended-learning-Ansätze und politische Maßnahmen zur Standardisierung der Ausbildung. (Rettinger u. a. 2025)
„Digital competencies in the bachelor’s degree in physiotherapy – a mixed methods study in Austria“ untersucht, inwieweit digitale Kompetenzen in den Curricula österreichischer Bachelorstudiengänge der Physiotherapie verankert sind und welche Fähigkeiten Absolventinnen und Absolventen benötigen, um Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitswesen professionell zu nutzen. Die Studie identifiziert insbesondere Kompetenzen im Umgang mit digitalen Gesundheitsdaten und Informationssystemen, der Einschätzung und Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz von Patientinnen und Patienten sowie der Weiterentwicklung der eigenen professionellen digitalen Gesundheitskompetenz. Sie kommt zu dem Schluss, dass digitale Kompetenzen über reine Bedienfertigkeiten hinausgehen und als zentrale Qualifikation verstanden werden, die systematisch curricular verankert sein sollte, um evidenzbasierte und verantwortungsvolle physiotherapeutische Praxis zu ermöglichen.
Der Artikel „Digital Health Hack September 2025 Dr. Sandra Bobersky“ beschreibt, wie das ZKIMED der Knappschaft Kliniken Bochum mit dem gestuften KI-Seepferdchen-Konzept seine Mitarbeitenden systematisch an den Einsatz von Künstlicher Intelligenz heranführt. Ziel ist es, Datenschutzaspekte zu verstehen, digitale Arbeitsprozesse zu erleichtern und Vorbehalte gegenüber KI abzubauen, während praxisnahe Kompetenzen stufenweise von Grundlagen bis zur Mitgestaltung neuer KI-Anwendungen vermittelt werden. (Bobersky und Bensch 2025)
Mehrere Studien untersuchen, wie interorganisationaler Wissenstransfer und gezielte Qualifizierungsmaßnahmen die digitale Transformation im Gesundheitswesen fördern und beschleunigen können. Die Studie „Interorganizational Knowledge Sharing to Establish Digital Health Learning Ecosystems: Qualitative Evaluation of a National Digital Health Transformation Program in England“ (Cresswell et al.) zeigt am Beispiel des englischen Global Digital Exemplar (GDE)-Programms, dass formale Wissensnetzwerke vor allem dann wirksam werden, wenn sie durch informelle Kontakte ergänzt werden und gemeinsame Kontexte sowie gegenseitiger Nutzen vorliegen. Ebenfalls im GDE-Programm angesiedelt, untersucht „Using Blueprints to promote inter-organizational knowledge transfer in digital health initiatives“ (Williams et al.), wie die als Wissensdokumente konzipierten Blueprints primär als Networking-Instrument fungierten und durch bilaterale Gespräche sowie informelle Communities of Practice den tatsächlichen Wissenstransfer ermöglichten. Die US-amerikanische Studie „Virtual Peer-to-Peer Learning to Enhance and Accelerate the Health System Response to COVID-19: The HHS ASPR Project ECHO COVID-19 Clinical Rounds Initiative“ (Hunt et al.) beschreibt ein großangelegtes virtuelles Peer-to-Peer-Lernnetzwerk, das während der Pandemie durch wöchentliche videobasierte Clinical Rounds einen schnellen, praxisnahen Austausch von Erfahrungen über regionale und nationale Grenzen hinweg ermöglichte. Ergänzend beleuchtet „Empowerment for the Digital Transformation: Results of a Structured Blended-Learning On-the-Job Training for Practicing Physicians in Germany“ (Bosch et al.) den individuellen Kompetenzaufbau und zeigt, dass ein strukturiertes Blended-Learning-Training bei niedergelassenen Ärzten in Deutschland das Wissen über zentrale Aspekte der Digitalisierung deutlich steigert und Unsicherheiten abbaut, jedoch die subjektive Bereitschaft zur aktiven Gestaltung der Transformation weiterhin begrenzt bleibt. Gemeinsames Thema aller Arbeiten ist die Erkenntnis, dass erfolgreicher Wissenstransfer und Kompetenzentwicklung im digitalen Gesundheitswesen vor allem durch Kombination formaler Strukturen mit informellen, nutzenorientierten und kontextsensiblen Austauschprozessen gelingt.
Der Artikel „Health Information Counselors: A New Profession for the Age of Big Data“ von Amelia Fiske, Alena Buyx und Barbara Prainsack, veröffentlicht 2018 in Academic Medicine, beschreibt die zunehmende Datenflut im Gesundheitswesen und die damit verbundenen Herausforderungen für Ärzte und Patienten. Die Autoren argumentieren, dass Gesundheitsfachkräfte oft weder Zeit noch ausreichende Kompetenzen besitzen, um Patienten bei der Interpretation vielfältiger, teils unvalidierter Daten aus Apps, Wearables oder Direct-to-Consumer-Tests zu unterstützen. Sie schlagen daher die Schaffung eines neuen Berufsstands vor: Health Information Counselors (HICs). Diese speziell ausgebildeten Fachkräfte sollen über Kenntnisse in Datenqualität, Statistik, Datenschutz, Kommunikation und grundlegender Klinik verfügen, um als Vermittler zwischen Patienten und Ärzten zu wirken, Daten sinnvoll zu interpretieren und informierte Entscheidungen in der datengetriebenen Medizin zu ermöglichen.
Digitale Fähigkeiten
Die Initiative Digitales Deutschland erforscht, welche Kompetenzen für die Teilhabe an der digitalen Transformation erforderlich sind. Durch eine Datenbank, den Kompass und qualitative Studien werden Medien- und Digitalkompetenzen der Bevölkerung analysiert. Die Initiative betont die Bedeutung lebenslangen Lernens, technischer Fähigkeiten, kritischen Denkens und sozialer Verantwortung. Forschungsergebnisse zu verschiedenen Altersgruppen werden bereitgestellt. Ziel ist es, Erkenntnisse für Bildung, Politik und Verwaltung zu liefern.
Digitale Gesundheitskompetenz
Die digitale Gesundheitskompetenz (DGK) ist definiert als die Fähigkeit, mit digitalen Gesundheitsinformationen umzugehen, um Gesundheit und Wohlbefinden zu fördern. Zwei repräsentative Studien, HLS-GER 2 und eine Untersuchung vom AOK Bundesverband, zeigen, dass trotz unterschiedlicher Methoden ein großer Teil der Bevölkerung eine geringe DGK aufweist. Diese Kompetenz ist eng mit Bildungsniveau, Sozialstatus, finanzieller Deprivation und Alter verbunden, was auf einen sozialen Gradienten hinweist. Während der COVID-19-Pandemie gab es Hinweise auf eine Verbesserung der DGK, doch bleibt Unsicherheit über die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung. Der Artikel betont die Notwendigkeit eines besseren rechtlichen Rahmens, finanzieller Ressourcen und einer solideren Datenbasis zur Förderung der DGK, um soziale Ungleichheiten zu verringern und die digitale Transformation im Gesundheitswesen zu unterstützen. (Dratva, Schaeffer, und Zeeb 2024)
Eine bundesweite Umfrage im Oktober 2020 mit 1014 Teilnehmern zeigte, dass eine Mehrheit (88,56%) glaubt, dass Digitalisierung zukünftig die Gesundheitsversorgung beeinflussen wird, jedoch nur 57,10% aktuell solche Technologien für Gesundheitszwecke nutzen. Über die Hälfte der Befragten (52,47%) erlebten ungenaue Informationen zur COVID-19-Pandemie online, obwohl 78,01% sich sicher fühlten, Fehlinformationen zu erkennen. Der Gebrauch digitaler Technologien zur Förderung körperlicher Aktivität war niedrig (21,70%). Trotz hoher wahrgenommener eHealth Kompetenz war nur 43,10% der Teilnehmer sicher, Gesundheitsentscheidungen basierend auf Online-Informationen zu treffen. Soziodemographische Faktoren wie höheres Einkommen, jüngeres Alter und höhere Bildung korrelierten mit mehr Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien. (De Santis u. a. 2021)
Eine Studie untersuchte die eHealth-Kompetenz und die Nutzung von Internet- und eHealth-Diensten in der deutschen Gemeinde Dingelstädt im ländlichen Thüringen. Mit 488 Rückmeldungen zeigte sich, dass 76,4% der Bevölkerung zukünftig digitale Medien für Gesundheitszwecke nutzen möchten. Es gab keine signifikante Alterskorrelation mit der Nutzung eHealth-Dienste, jedoch zeigte sich, dass niedrige Bildungsniveaus mit einem geringeren Verständnis und Vertrauen in digitale Gesundheitsinformationen verbunden waren. Die Mehrheit der Teilnehmer verwendet täglich das Internet. Trotzdem fühlen sich viele unsicher, Gesundheitsentscheidungen basierend auf Online-Informationen zu treffen, was auf eine Lücke zwischen digitalen Fähigkeiten und Vertrauen hinweist. Die Studie betont die Notwendigkeit, Bürger mit ausreichenden digitalen Fertigkeiten auszustatten, um von der Digitalisierung des Gesundheitswesens zu profitieren. (Cramer u. a. 2023)
Der Zusammenhang zwischen soziodemografischen Faktoren, digitaler Gesundheitskompetenz und der Nutzung von Wearables für Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention in Deutschland wurde mittels einer landesweiten Querschnittsumfrage im November 2022 untersucht. Unter den 932 Teilnehmern nutzten 24% Wearables zur Gesundheitsüberwachung, wobei die Nutzung bei älteren, niedrigerem Bildungstatus, in kleineren Haushalten, mit niedrigerem Einkommen und in kleineren Städten oder neuen Bundesländern geringer war. Ein deutlicher generationsbedingter Unterschied wurde festgestellt, wobei jüngere Erwachsene (18-40 Jahre) eine höhere Nutzung aufwiesen, unabhängig von ihrer digitalen Gesundheitskompetenz. Bei älteren Erwachsenen war jedoch eine höhere digitale Gesundheitskompetenz mit einer höheren Wahrscheinlichkeit der Nutzung von Wearables verbunden. Die digitale Gesundheitskompetenz wurde mit dem eHealth Literacy Scale (eHEALS) gemessen und zeigte, dass sie die Beziehung zwischen Alter und Wearable-Nutzung teilweise abbildet. Diese Ergebnisse weisen auf soziodemografische Disparitäten hin und betonen die Notwendigkeit, digitale Gesundheitskompetenz zu fördern, um die Nutzung von Gesundheitstechnologien zu erleichtern und eine gerechtere Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. (Pan u. a. 2024)
Der Artikel „Förderung digitaler Gesundheitskompetenz in benachteiligten Lebenslagen durch Community-orientierte Ansätze“ beschreibt die Ergebnisse eines Workshops auf der 58. Jahrestagung der DGSMP. Ziel war es, Herausforderungen und Potenziale der Förderung digitaler Gesundheitskompetenz (DiGeKo) bei benachteiligten Gruppen zu identifizieren. Durch interaktive Methoden wie Perspektivwechsel und Zukunftswerkstatt wurden spezifische Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung, älteren Menschen/Pflegebedürftigen und Schüler:innen erarbeitet. Die Ergebnisse betonen die Notwendigkeit zielgruppengerechter, Community-orientierter Ansätze, um DiGeKo effektiv zu fördern, und fordern weitere Forschung sowie die Integration digitaler und präsentischer Angebote. (Wrona u. a. 2025)
Die Studie „Determinants of Digital Health Literacy: International Cross-Sectional Study“ untersucht die digitale Gesundheitskompetenz in Großbritannien, Schweden, Italien und Deutschland. Die Ergebnisse zeigen, dass die digitale Gesundheitskompetenz (gemessen mit der eHEALS-Skala, Mittelwert 29,2) je nach Alter, Gesundheitsstatus und Wohnsitzland variiert. Personen im Alter von 25–44 Jahren weisen höhere Kompetenz auf, während Personen über 55 Jahre niedrigere Werte zeigen. Ein besserer Gesundheitsstatus korreliert mit höherer digitaler Gesundheitskompetenz. Teilnehmer aus Großbritannien und Schweden haben höhere Werte als die aus Deutschland, während kein Unterschied zu Italien besteht. Geschlecht und Ethnizität hatten keinen signifikanten Einfluss. Gezielte Bildungsprogramme für ältere und gesundheitlich beeinträchtigte Personen sowie zugängliche digitale Gesundheitslösungen sind notwendig, um Gesundheitsungleichheiten zu verringern. (Qiu u. a. 2025)
Digitale Kompetenz messen
Der Artikel “Development of the Digital Health Literacy Instrument: Measuring a Broad Spectrum of Health 1.0 and Health 2.0 Skills” beschreibt die Entwicklung des Digital Health Literacy Instrument (DHLI), das sowohl Health 1.0- als auch Health 2.0-Kompetenzen misst, einschließlich operativer Fähigkeiten, Navigation, Informationssuche, Bewertung von Zuverlässigkeit und Relevanz, Hinzufügen eigener Inhalte und Schutz der Privatsphäre. In einer Stichprobe der niederländischen Bevölkerung (N=200) zeigte die Selbsteinschätzungsskala (21 Items) gute Reliabilität (Cronbachs Alpha = .87) und Validität, während die sieben performancebasierten Items einzeln interpretiert werden sollten, da sie kein einheitliches Konstrukt bildeten. Das Instrument korrelierte wie erwartet mit Alter, Bildung, Internetnutzung, Gesundheitsstatus und anderen Gesundheitskompetenz-Skalen, wobei die Ergebnisse auf die Notwendigkeit weiterer Forschung in anderen Sprachen und Populationen hinweisen. (Van Der Vaart und Drossaert 2017)
Die Studie „eHEALS: The eHealth Literacy Scale“ von Cameron D. Norman und Harvey A. Skinner entwickelte ein 8-Item-Instrument zur Messung der eHealth-Literacy, also der Fähigkeit, elektronische Gesundheitsinformationen zu finden, zu bewerten und anzuwenden. Ziel war es, die psychometrischen Eigenschaften des eHEALS in einer Jugendpopulation zu evaluieren, die aufgrund ihrer Vertrautheit mit Technologie als Testgruppe diente. Die Studie mit 664 Teilnehmern im Alter von 13 bis 21 Jahren zeigte eine hohe interne Konsistenz (α = .88) und moderate Test-Retest-Reliabilität (r = .40 bis .68) über sechs Monate. Eine Hauptkomponentenanalyse ergab eine einheitliche Faktorstruktur, die 56 % der Varianz erklärte. Das eHEALS erweist sich als vielversprechendes Werkzeug zur Beurteilung der eHealth-Kompetenzen, insbesondere in klinischen Kontexten, wobei weitere Forschung für andere Populationen und den Zusammenhang mit Gesundheitsoutcomes nötig ist. (Norman und Skinner 2006)
Die Studie „Assessing Competencies Needed to Engage With Digital Health Services: Development of the eHealth Literacy Assessment Toolkit“ hatte das Ziel, ein validiertes Toolkit (eHLA) zur Einschätzung der E-Health-Literacy zu entwickeln und zu testen. Hierzu wurden von 2011 bis 2015 sieben Instrumente aus den Bereichen Gesundheits- und Digitalkompetenz entwickelt oder adaptiert und in einer Stichprobe von 475 Personen validiert. Das eHLA beinhaltet vier gesundheitsbezogene und drei digitalitätsbezogene Kurzskalen, mit denen individuelle Kompetenzen und Fertigkeiten hinsichtlich digitaler und gesundheitlicher Themen zuverlässig erfasst werden können. Die Instrumente wurden anhand psychometrischer Analysen bezüglich Reliabilität und Validität optimiert und eignen sich besonders für Screening-Zwecke in eHealth-Projekten. (Karnoe u. a. 2018)
Die digitale Kompetenz von Gesundheitsfachkräften ist ein zentrales Thema in der modernen Gesundheitsversorgung, da digitale Technologien zunehmend an Bedeutung gewinnen. Eine Scoping Review von Mainz et al. (2024) “Measuring the Digital Competence of Health Professionals: Scoping Review” untersucht Definitionen und Messinstrumente für digitale Kompetenz im Gesundheitswesen. Die Analyse von 46 Studien zeigt, dass digitale Kompetenz oft auf technische Fähigkeiten und Wissen fokussiert, aber auch methodische, soziale und persönliche Kompetenzen umfasst. Bestehende Messinstrumente basieren hauptsächlich auf Selbsteinschätzungen und vernachlässigen die Komplexität des Konstrukts. Eine einheitliche Definition und validierte Messmethoden sind notwendig, um die digitale Kompetenz umfassend zu erfassen und die Ausbildung entsprechend anzupassen. (Mainz u. a. 2024)
Digitale Kompetenzen für Leistungserbringende
Die Webseite der GMDS (Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie) beschreibt die Arbeit mehrerer Arbeitsgruppen zur Entwicklung von Lernziel- und Kompetenzkatalogen (LZK) für Biometrie, Epidemiologie und Medizinische Informatik. Diese umfassen Kataloge für Medizinische Biometrie (2021), Epidemiologie (2019), Medizinische Informatik (2020) sowie Bachelor-Studiengänge in (Bio-)Medizinischer Informatik (2021, aktualisiert 2025) und Pflegeinformatik (2017). Die AGs kooperieren mit dem SMITH Joint Expertise Center for Teaching (SMITH-JET) und entwickeln das webbasierte Tool HI-LONa, das alle genannten Kataloge integriert und Funktionen zur Kommentierung und Überarbeitung bietet. HI-LONa, der Health Informatics Learning Objective Navigator, ist ein Online-Tool zur Unterstützung des Lernens in der biomedizinischen und Gesundheitsinformatik. Es bietet Kataloge mit Lernzielen, Modulbeschreibungen und administrative Funktionen für Studienprogramme.
Der Universitätslehrgang Health Information Management an der UMIT TIROL vermittelt fundierte Kenntnisse in der Informations- und IT-Verwaltung im Gesundheitswesen. Die Studieninhalte umfassen unter anderem Projektmanagement, IT-gestütztes Prozessmanagement, Informationssysteme und deren Management, elektronische Gesundheitsakten, semantische Interoperabilität, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Zusätzlich werden Themen wie Softwarequalität, Zertifizierung und rechtliche Grundlagen von Medizinsoftware sowie evidenzbasierte Medizinische Informatik behandelt. Das Studium befähigt dazu, komplexe Informationssysteme im Gesundheitswesen zu analysieren, zu gestalten und zu evaluieren sowie innovative digitale Gesundheitslösungen zu entwickeln.
Das BÄK-Curriculum „Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung“ (2. Auflage, 23.09.2022) der Bundesärztekammer vermittelt Ärzten Kompetenzen im Umgang mit digitalen Gesundheitsanwendungen. Es umfasst ein 8-stündiges Basismodul zur Nutzung von eHealth-Anwendungen wie Telematikinfrastruktur, Telemedizin und medizinischen Apps sowie ein 16-stündiges Aufbaumodul zu Interoperabilität, Datenschutz, Wissensmanagement und ethischen Aspekten. Ziel ist es, Ärzte auf die digitale Transformation im Gesundheitswesen vorzubereiten, um Prozesse, Kommunikation und Patientenversorgung zu optimieren. Die Fortbildung richtet sich an ambulant und stationär tätige Ärzte und kann in Präsenz- oder Blended-Learning-Formaten absolviert werden.
Die Studie „On the Effective Dissemination and Use of Learning Objectives Catalogs for Health Information Curricula Development“ von Oliver J. Bott et al. untersucht die Herausforderungen und gibt Empfehlungen zur Förderung der Verbreitung und Nutzung kompetenzbasierter Lernzielkataloge (CLO) in den Gesundheitsdaten- und Informationswissenschaften in Deutschland. Während CLO in der Medizin weit verbreitet sind, ist ihre konsistente Anwendung in Disziplinen wie Epidemiologie, Biometrie, Medizinischer Informatik und Pflegeinformatik noch nicht etabliert. Durch einen öffentlichen Online-Workshop im Rahmen der GMDS-Jahreskonferenz 2022 wurden Hindernisse wie unklare Kompetenzdefinitionen, begrenzte Ressourcen und mangelnde Akzeptanz identifiziert. Die Studie empfiehlt strukturierte, klar definierte Lernziele, Unterstützung durch wissenschaftliche Fachgesellschaften, Bereitstellung von Schulungen und Tools sowie die Förderung der Akzeptanz durch Best-Practice-Beispiele, um die curriculare Entwicklung zu verbessern. (Bott u. a. 2023)
Die Studie „Digital health competencies for primary healthcare professionals: A scoping review“ von Geronimo Jimenez et al. (2020) untersucht, welche digitalen Gesundheitskompetenzen für Fachkräfte in der Primärversorgung erforderlich sind. Grundlage ist eine Scoping-Review-Analyse von 28 wissenschaftlichen Arbeiten, die überwiegend vor 2005 veröffentlicht wurden und sich vor allem auf Hausärzte, Allgemeinmediziner und Medizinstudierende in westlichen Industrieländern konzentrieren. Identifiziert wurden 17 Kompetenzbereiche, die unter anderem IT- und medizinische Informatikkenntnisse, grundlegende Computer- und Informationskompetenz sowie die optimale Nutzung elektronischer Patientenakten umfassen. Die Autoren betonen den Bedarf an einer aktuellen, einheitlichen und praxisrelevanten Definition solcher Kompetenzen, die in Aus- und Weiterbildung integriert werden sollte, um die Einführung digitaler Gesundheitstechnologien in der Primärversorgung zu fördern. (Jimenez u. a. 2020)
Die Studie „Referential Competencies in Digital Health: A Necessity for the Digital Transformation of Future Clinical Professionals“ beschreibt die Entwicklung eines Referenzmodells für digitale Gesundheitskompetenzen, das insbesondere klinische Fachkräfte bei der digitalen Transformation unterstützen soll. Grundlage des Modells ist eine qualitative Methodik mit Literaturrecherche und Fokusgruppen, aus der 103 Kompetenzen in neun Domänen für vier Nutzergruppen – Entscheidungsträger, IT-Fachkräfte, Kliniker und Patienten – abgeleitet wurden. Für klinische Anwender werden 28 Kernkompetenzen vorgestellt, die Bereiche wie Veränderungsmanagement, Prozessgestaltung, Interoperabilität, Innovation, klinische Entscheidungsunterstützung, Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten, Telemedizin sowie ethisch-rechtliche Aspekte abdecken. Ziel des Modells ist es, Ausbildungsprogramme, Reifegradbewertungen und Personalentwicklung im Gesundheitswesen, insbesondere in Lateinamerika, an lokale und regionale Anforderungen anzupassen und so eine sichere, effiziente und patientenzentrierte Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien zu fördern. (Sandra Gutiérrez, Torres, Molina, Corvalán, u. a. 2025)
Die Studie mit dem Titel „Healthcare professionals’ competence in digitalisation: A systematic review“ untersucht die Kompetenzen von medizinischen Fachkräften im Bereich der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Die systematische Übersichtsarbeit fasst Erkenntnisse aus 12 Studien zusammen und identifiziert Schlüsselkompetenzen wie technisches Wissen, digitale Fertigkeiten für die Patientenversorgung, soziale und kommunikative Fähigkeiten sowie ethische Aspekte. Die Autorinnen und Autoren betonen die Bedeutung von Motivation, Bereitschaft und Unterstützung im beruflichen Umfeld für die erfolgreiche Integration digitaler Technologien. Empfehlungen umfassen die Förderung digitaler Kompetenzen durch gezielte Schulungen sowie die Bereitstellung angemessener Ressourcen und Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz. Ziel ist es, sowohl die Patientensicherheit als auch die Qualität der Versorgung durch digitale Anwendungen zu verbessern. Die Studie wurde im Journal of Clinical Nursing veröffentlicht und basiert auf Forschungen aus verschiedenen Ländern. (Konttila u. a. 2019)
Die Studie mit dem Titel „Understanding the gap: a balanced multi-perspective approach to defining essential digital health competencies for medical graduates“ untersucht die grundlegenden digitalen Gesundheitskompetenzen, die Medizinstudierende für eine sichere und effektive Praxis in einer zunehmend digitalisierten Gesundheitsumgebung benötigen. Dabei werden aus den Perspektiven von Studierenden, Lehrenden und Experten im digitalen Gesundheitsbereich vier zentrale Kompetenzbereiche identifiziert: 1. Verständnis des lokalen digitalen Gesundheitssystems, 2. sichere und ethische Informationsverwaltung, 3. praktische Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Gesundheitswerkzeugen und 4. wissenschaftliches Arbeiten und evidenzbasierte Praxis. Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, diese Kompetenzen zielgerichtet und kontextbezogen in die medizinische Ausbildung zu integrieren, wobei unterschiedliche Vorerfahrungen und Fähigkeiten der Studierenden berücksichtigt werden sollen. Ziel ist es, die medizinischen Absolventen bestmöglich auf den digitalen Wandel im Gesundheitswesen vorzubereiten. (Brett Sumner u. a. 2025)
Die Studie mit dem Titel „Digital Health Competencies Among Health Care Professionals: Systematic Review“ fasst systematisch die digitalen Gesundheitskompetenzen zusammen, die bei Gesundheitsfachkräften bis September 2021 untersucht wurden. Ziel war es, die bisher erforschten Kompetenzen sowie die verwendeten Messinstrumente zu erfassen. Die systematische Übersichtsarbeit basiert auf 26 Studien, überwiegend quantitativen Querschnittsuntersuchungen, deren methodische Qualität meist moderat bis gering war. Es wurden vier Hauptkategorien von digitalen Gesundheitskompetenzen identifiziert: selbst eingeschätzte Kompetenzen, psychologische und emotionale Aspekte im Umgang mit digitalen Technologien, die Nutzung der Technologien sowie deren Wissen. Die Ergebnisse sollen helfen, Ausbildungskonzepte gezielt weiterzuentwickeln und Forschungslücken in diesem Bereich aufzuzeigen. (Longhini, Rossettini, und Palese 2022)
Die Studie „Digital Health Competencies: Core to Effective Health Sector Leadership“ untersucht die zentralen digitalen Gesundheitskompetenzen, die Führungskräfte im Gesundheitswesen (Healthcare Decision-Makers, HDMs) benötigen, um digitale Transformationsprozesse erfolgreich zu gestalten. Grundlage ist die zweite Version des vom chilenischen National Center for Health Information Systems entwickelten Kompetenzmodells, das auf einer umfassenden Literaturrecherche und Fokusgruppen mit 61 Fachpersonen basiert. Das Modell definiert insgesamt 103 Kompetenzen in neun Domänen, von denen 32 speziell auf Entscheidungsträger zugeschnitten sind, darunter Themen wie Digitalisierungsmanagement, Prozessarchitektur, Interoperabilität, Innovation, Telemedizin, Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten sowie ethische, rechtliche und Governance-Aspekte. Ziel ist es, Ausbildungsprogramme, Reifegradanalysen und organisatorische Strategien zu unterstützen, um informierte Entscheidungen, bessere Patientenergebnisse und eine nachhaltige digitale Transformation im Gesundheitswesen zu fördern. (Sandra Gutiérrez, Torres, Molina, und Härtel 2025)
Die Studie „Enhancing Digital Readiness and Capability in Healthcare: A Systematic Review of Interventions, Barriers, and Facilitators“ untersucht systematisch, wie die digitale Bereitschaft und Kompetenz von Gesundheitsfachkräften verbessert werden kann. Ziel war es, Interventionsansätze zu bestimmen und die wichtigsten Hindernisse sowie fördernden Faktoren im digitalen Transformationsprozess zu identifizieren. Als methodischer Rahmen diente das UTAUT-Modell (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology), um die Einflussfaktoren für die Akzeptanz digitaler Technologien zu analysieren. Die Auswertung von 21 Studien ergab, dass insbesondere ausreichende Schulungen, organisatorische Unterstützung und benutzerfreundliche Systeme die digitale Kompetenz fördern, während mangelnde Infrastruktur, unzureichende Trainings und komplexe Anwendungen als Hürden gelten. Soziale Einflüsse und gemeinsame Entscheidungsfindung spielen ebenfalls eine bedeutsame Rolle für die erfolgreiche Adaption digitaler Technologien im Gesundheitswesen. (Alotaibi, Wilson, und Traynor 2025)
Der Titel der Studie lautet „Telehealth Competencies in Medical Education: New Frontiers in Faculty Development and Learner Assessments“. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen der raschen Ausweitung von Telemedizin, insbesondere im Zuge der COVID-19-Pandemie, auf die medizinische Ausbildung und die notwendigen Kompetenzen von Lehrenden und Lernenden. Im Mittelpunkt stehen die von der Association of American Medical Colleges (AAMC) und der Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) entwickelten Kompetenzbereiche, die unter anderem Kommunikation, Datenerhebung und Patientensicherheit im digitalen Gesundheitswesen umfassen. Die Studie beschreibt zudem Strategien zur Integration dieser Kompetenzen in die medizinische Lehre und stellt Instrumente für die direkte und strukturierte Beobachtung zur Beurteilung von Telemedizin-Fähigkeiten vor. (Noronha u. a. 2022)
Die Studie „Digital health competencies for primary healthcare professionals: A scoping review“ von Geronimo Jimenez et al. (2020) untersucht, welche digitalen Gesundheitskompetenzen für Fachkräfte in der Primärversorgung erforderlich sind. Grundlage ist eine Scoping-Review-Analyse von 28 wissenschaftlichen Arbeiten, die überwiegend vor 2005 veröffentlicht wurden und sich vor allem auf Hausärzte, Allgemeinmediziner und Medizinstudierende in westlichen Industrieländern konzentrieren. Identifiziert wurden 17 Kompetenzbereiche, die unter anderem IT- und medizinische Informatikkenntnisse, grundlegende Computer- und Informationskompetenz sowie die optimale Nutzung elektronischer Patientenakten umfassen. Die Autoren betonen den Bedarf an einer aktuellen, einheitlichen und praxisrelevanten Definition solcher Kompetenzen, die in Aus- und Weiterbildung integriert werden sollte, um die Einführung digitaler Gesundheitstechnologien in der Primärversorgung zu fördern. (Jimenez u. a. 2020)
Die Studie „Referential Competencies in Digital Health: A Necessity for the Digital Transformation of Future Clinical Professionals“ beschreibt die Entwicklung eines Referenzmodells für digitale Gesundheitskompetenzen, das insbesondere klinische Fachkräfte bei der digitalen Transformation unterstützen soll. Grundlage des Modells ist eine qualitative Methodik mit Literaturrecherche und Fokusgruppen, aus der 103 Kompetenzen in neun Domänen für vier Nutzergruppen – Entscheidungsträger, IT-Fachkräfte, Kliniker und Patienten – abgeleitet wurden. Für klinische Anwender werden 28 Kernkompetenzen vorgestellt, die Bereiche wie Veränderungsmanagement, Prozessgestaltung, Interoperabilität, Innovation, klinische Entscheidungsunterstützung, Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten, Telemedizin sowie ethisch-rechtliche Aspekte abdecken. Ziel des Modells ist es, Ausbildungsprogramme, Reifegradbewertungen und Personalentwicklung im Gesundheitswesen, insbesondere in Lateinamerika, an lokale und regionale Anforderungen anzupassen und so eine sichere, effiziente und patientenzentrierte Nutzung digitaler Gesundheitstechnologien zu fördern. (Sandra Gutiérrez, Torres, Molina, Corvalán, u. a. 2025)
Das Paper „Educating the Healthcare Workforce to Support Digital Transformation“ beschreibt die Notwendigkeit, die Gesundheitsberufe durch gezielte Bildungsprogramme auf die digitale Transformation vorzubereiten. Es betont die Bedeutung vielfältiger Schulungsangebote, die sowohl Anfänger als auch Experten ansprechen, die digitale Lösungen einführen. Digitale Kompetenzen sollen früh in die Ausbildung integriert werden, gestützt durch Kompetenzrahmen, die Regulierungsbehörden und Bildungsanbieter leiten. Die Autoren beschreiben die Entwicklung solcher Rahmen und innovativer Bildungsprogramme an der Universität Manchester, darunter ein Massive Online Open Course (MOOC) und ein Weiterbildungsprogramm für Englands Topol Digital Fellows. Diese Initiativen zielen darauf ab, die digitale Gesundheitslandschaft nachhaltig zu stärken. (A. C. Davies u. a. 2022)
Rahmenwerke für Digitale Kompetenzen
Das KODE Framework unterstützt die Erfassung und Entwicklung digitaler Kompetenzen für die ärztliche Praxis (Nur Nazeha u. a. 2020; Sergio Gutiérrez, Torres, Molina, und al. 2025). Das DigComp Framework definiert digitale Fähigkeiten in fünf Bereichen, die für die medizinische Ausbildung adaptiert werden (Nur Nazeha u. a. 2020; Josip Car, Ong, Erlikh Fox, und al. 2025). Das DECODE Framework bietet 19 Kompetenzen in vier Domänen für die digitale Gesundheitsausbildung (Josip Car, Ong, Erlikh Fox, und al. 2025). Das Health Information Technology Competencies Framework umfasst 21 Kompetenzbereiche für interdisziplinäre Teams (Nur Nazeha u. a. 2020). Das CENS Digital Health Competency Model enthält 103 Kompetenzen in neun Domänen für verschiedene Nutzergruppen (Sergio Gutiérrez, Torres, Molina, und al. 2025; Sergio Gutiérrez, Torres, Molina, und Härtel 2025). Das Core Competency Framework for Clinical Informatics definiert 111 Kompetenzen für klinische Informatiker (A. Davies u. a. 2022). Das Digital Transformation Skills Framework (DTSF) deckt 44 Einzelfähigkeiten für digitale Arbeitsprozesse ab (Bouwmans u. a. 2024). DigiHealthCom und DigiComInf sind validierte Instrumente zur Messung digitaler Gesundheitskompetenz (Jarva u. a. 2023). Ein kontextbezogener Rahmen für Medizinstudenten beschreibt vier essentielle Domänen für digitale Kompetenzen (Ben Sumner u. a. 2025).
Weiteres
Der Artikel „Evolving Medical Students’ Digital Health Perceptions and Intentions: Insights From a Prepandemic and Postpandemic Survey Study“ von Mickaël Ringeval, Louis Raymond, Marie-Pascale Pomey und Guy Paré wurde am 3. September 2025 im Journal of Medical Internet Research (Vol. 27) veröffentlicht. Die Studie untersuchte an einer kanadischen Medizinhochschule die Faktoren, die die Absicht von Medizinstudenten beeinflussen, digitale Gesundheitstechnologien in ihre zukünftige Praxis zu integrieren, und verglich Wahrnehmungen vor (N=184) und nach (N=177) der COVID-19-Pandemie. Über 85 % der Befragten hielten eine obligatorische digitale Gesundheitsausbildung für erforderlich; die Nutzungsabsicht stieg signifikant in Bereichen wie Patientenkommunikation, Monitoring sowie Diagnose und Behandlung. Wahrgenommener Nutzen und Überzeugungen zu KI waren starke Prädiktoren; die Erklärungskraft des Modells nahm postpandemisch ab, was auf komplexere Einflussfaktoren hinweist. Die Autoren empfehlen die Integration formaler digitaler Gesundheitsausbildung in Medizincurricula.
Der Artikel „Relevanz der digitalen Gesundheitskompetenz (dGK) für Versorgungsforschung und -praxis – Teil I“ (DOI: 10.1055/a-2663-4406) und „Teil II“ (DOI: 10.1055/a-2674-1729) erschienen in der Zeitschrift Das Gesundheitswesen. Die Autoren der AG Digital Health des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung e.V. (DNVF) leiten in Teil I eine theoriebasierte Arbeitsdefinition der dGK als Erweiterung der Gesundheitskompetenz her, die das Suchen, Finden, Verstehen, Bewerten und Anwenden digitaler Gesundheitsinformationen umfasst. Sie grenzen dGK von GK ab und operationalisieren sie multidimensional auf individueller, interaktionsbezogener und Systemebene. Teil II beleuchtet den „digital divide“ in Deutschland, assoziiert niedrige dGK mit niedrigem sozioökonomischem Status und höherem Alter und schlägt theoriegeleitete, nutzerzentrierte Interventionen zur Förderung der dGK vor, inklusive Evaluation und Implementierung.
Die Studie „The algorithmic consultant: a new era of clinical AI calls for a new workforce of physician-algorithm specialists“ von Jayson S. Marwaha, William Yuan und Gabriel A. Brat, veröffentlicht am 27. August 2025 in npj Digital Medicine, fordert die Schaffung eines neuen ärztlichen Spezialberufs: den „algorithmischen Berater“ (physician-algorithm specialist). Analog zum klinischen Pharmazeuten, der den sicheren und wirksamen Einsatz von Medikamenten gewährleistet, soll dieser Facharzt die Lücke zwischen komplexen KI-Systemen und behandelnden Ärzten schließen. Er übernimmt zwei Kernaufgaben: die punktuelle Beratung am Patientenbett bei der Auswahl und Interpretation von KI-Tools sowie die institutsweite Governance des KI-Ökosystems (Auswahl, Validierung, Fairnessprüfung und Lebenszyklus-Management von Algorithmen). Die Autoren begründen dies mit empirischen Befunden, wonach die direkte Nutzung von KI durch Ärzte ohne fachkundige Unterstützung die Entscheidungsqualität häufig nicht verbessert und teilweise sogar verschlechtern kann. Nur durch diese spezialisierte Schnittstelle könne das Potenzial klinischer KI sicher und effektiv in die Praxis überführt werden.
Das Clinicum Digitale ist eine interdisziplinäre Spring School des Else Kröner Fresenius Zentrums für Digitale Gesundheit (EKFZ) an der Technischen Universität Dresden. Sie richtet sich an Studierende der Medizin, Natur- und Ingenieurwissenschaften und findet vom 16. bis 25. März 2026 statt. Ziel der Veranstaltung ist es, den Austausch zwischen Medizin und Technik zu fördern, Grundlagen der jeweils anderen Disziplin zu vermitteln und gemeinsame Innovationsprojekte in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik und Medizintechnik zu entwickeln. Teilnehmende arbeiten in interprofessionellen Teams an praxisnah an medizintechnischen Fragestellungen, erhalten Einblicke zum Beispiel in Notfallmedizin, Klinikalltag oder Programmierung und haben die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Klinik zu vernetzen.
Der Artikel „Why Clinicians Hold the Key to Fixing Health Care’s Complexity Problem“ von Alejandro Quiroga und Thomas H. Lee erschien am 9. Dezember 2025 in NEJM Catalyst. Die Autoren argumentieren, dass viele aktuelle Herausforderungen im Gesundheitswesen komplex statt lediglich kompliziert sind und herkömmliche Managementansätze – die auf Messbarkeit, Effizienz und Standardisierung setzen – hier an ihre Grenzen stoßen. Entscheidungsprozesse, die Kliniker während Medizinstudium und Facharztausbildung erlernen, wie Teamarbeit, Hypothesenprüfung und schnelle Anpassung, seien dagegen deutlich besser für komplexe Probleme geeignet als die in Wirtschafts- und Verwaltungsstudiengängen vermittelten Methoden. Gesundheitssysteme könnten daher spürbar flexibler und effektiver werden, indem sie diese klinischen Kompetenzen systematisch auch auf administrative und operative Herausforderungen anwenden.
„Kompass: Künstliche Intelligenz und Kompetenz 2025. Einstellungen, Handeln und Kompetenzentwicklung im Kontext von KI“ von Laura Cousseran, Achim Lauber, Niels Brüggen, Laura Sūna und Cornelia Bogen ist der Bericht zur dritten repräsentativen Welle des Verbundprojekts „Digitales Deutschland“. Die im Frühjahr 2025 durchgeführte telefonische Befragung (n = 2.013 Personen ab 12 Jahren) zeigt, dass Künstliche Intelligenz in der Bevölkerung angekommen ist: 96 % kennen den Begriff (2023: 86 %), und die Assoziationen haben sich von Robotik hin zu generativen Anwendungen wie ChatGPT und KI-generierten Inhalten verschoben. Gleichzeitig bleibt die Haltung ambivalent – KI wird persönlich und gesellschaftlich sowohl als Chance als auch als Risiko wahrgenommen, wobei Frauen und ältere Befragte 2025 tendenziell kritischer urteilen als 2023. Wissens- und Kompetenzlücken bestehen weiterhin, insbesondere beim Erkennen von KI in Alltagsanwendungen, beim Datenschutz sowie beim selbstständigen Beheben technischer Probleme. Kreative Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien und KI werden von der Bevölkerung vergleichsweise gering geschätzt. Die Studie identifiziert anhaltende Förderbedarfe und liefert konkrete Ansatzpunkte für Bildungspraxis und Politik, um eine souveräne Teilhabe an der digitalen Gesellschaft zu ermöglichen.
Das „bidt-Digitalbarometer 2025“ ist eine repräsentative Bevölkerungsbefragung des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation (bidt), die im Zeitraum vom 22. Januar bis 6. März 2025 mit 9.031 Personen ab 14 Jahren online und telefonisch durchgeführt wurde. Die Studie liefert aktuelle Daten und Vergleiche zu 2021 zum Stand der digitalen Transformation in Deutschland, insbesondere zu digitalem Nutzungsverhalten, allgemeinen digitalen Kompetenzen sowie erstmals zu KI-Kompetenzen. Sie zeigt persistierende digitale Kompetenzklüfte nach Alter, Bildung und Einkommen, eine höhere Weiterbildungsbereitschaft in Ausbildung und Berufsleben im Vergleich zum Ruhestand sowie einen Zusammenhang zwischen dem Einsatz generativer KI und höheren KI-Kompetenzen. Das Barometer betont die Notwendigkeit lebensphasen- und bedarfsgerechter Weiterbildungsangebote, stärkerer Verzahnung von KI-Kompetenzen in schulischer und beruflicher Bildung sowie Unterstützung durch Unternehmen und Staat, um digitale Spaltungen zu verringern.
Der Artikel „Artificial Intelligence Readiness Among Young Family Doctors in Europe“ von Seyma Handan Akyon und Kollegen, veröffentlicht in den Annals of Family Medicine (November 2025, Band 23, Heft 6), untersucht die Bereitschaft junger Hausärzte in Europa gegenüber Künstlicher Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen. In einer Querschnittsstudie mit 134 Teilnehmern aus 20 Ländern wurde der validierte Medical AI Readiness Scale (MAIRS) eingesetzt, der einen medianen Gesamtwert von 69 von 110 Punkten ergab. Die Bereitschaft stieg signifikant mit dem Wissen über aktuelle KI-Anwendungen und deren Nutzung im Gesundheitsbereich an; männliche Teilnehmer zeigten eine höhere Bereitschaft. Die Autoren schlussfolgern, dass die begrenzte KI-Bereitschaft auf die Notwendigkeit gezielter Fortbildungen und kollaborativer Ansätze hinweist, um eine effektive Integration in die Primärversorgung zu ermöglichen. Die Studie weist Einschränkungen wie Stichprobenverzerrung und kleine Fallzahl auf.
Der Artikel „Effectiveness of Interventions for Addressing Digital Exclusion in Older Adults in the Social Care Domain: Rapid Review“ wurde am 30. Dezember 2025 in JMIR Aging (Band 8, e70377) veröffentlicht. Diese Rapid Review analysiert 21 vergleichende Studien aus den Jahren 2018 bis 2023 und zeigt, dass multicomponent-Interventionen, die physische, persönliche und perzeptuelle Barrieren abbauen sowie digitale Kompetenzen fördern, die digitale Literalität, Selbstwirksamkeit und Technologienutzung bei älteren Erwachsenen (ab 60 Jahren) verbessern können. Die Effekte erstrecken sich auch auf vulnerable Subgruppen wie ländlich lebende oder sozial isolierte Personen. Aufgrund methodischer Limitationen und mangelnder Power aller Studien bleibt die Evidenz jedoch unsicher, und weitere hochwertige Forschung wird empfohlen, um die Wirksamkeit zuverlässig zu bewerten. Zudem sollte berücksichtigt werden, dass nicht alle Älteren digitale Technologien nutzen möchten.
Der Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit und stellt keine Rechtsberatung dar. Anmerkungen können in der rechten Seitenleiste mit Hypothes.is sozialem Annotierungswerkzeug oder am unteren Ende einer Seite mit GitHub Giscus Diskussionen hinterlassen werden.