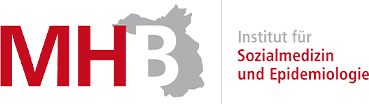Digitale Trennung
Die Studie „Bridging the digital health divide: a narrative review of the causes, implications, and solutions for digital health inequalities“ beschreibt die digitale Gesundheitskluft auf drei Stufen:
Erste Stufe (Zugang): Ungleichheiten im Zugang zu digitaler Technologie, wie Internet und Geräten (z. B. Smartphones), die oft mit sozioökonomischem Status verbunden sind. In einkommensschwachen Ländern oder Regionen bleibt die Erschwinglichkeit ein Hindernis.
Zweite Stufe (Fähigkeiten): Unterschiede in den Kenntnissen und Fähigkeiten, digitale Gesundheitsdienste zu nutzen, einschließlich digitaler Gesundheitskompetenz. Dies umfasst das Finden, Interpretieren und Anwenden von Gesundheitsinformationen sowie das Navigieren in digitalen Plattformen.
Dritte Stufe (Nutzen): Ungleichheiten in den gesundheitlichen Vorteilen, die aus digitalen Technologien resultieren. Selbst bei Zugang und Fähigkeiten profitieren nicht alle gleichermaßen, z. B. aufgrund sozioökonomischer Faktoren, was bestehende Gesundheitsungleichheiten verstärken kann.
Digitale Trennung im Unterschied von Stadt und Land
Städtische Arztpraxen sind laut der Studie Lower Electronic Health Record Adoption and Interoperability in Rural Versus Urban Physician Participants deutlich stärker digitalisiert als ländliche Praxen, mit einer EHR-Adoptionsrate von 74 % im Vergleich zu 64 % und höherer Interoperabilität, beeinflusst durch Praxisgröße, Ressourcenknappheit und Standort in Versorgungsmangelgebieten (Anzalone, Geary, und Dai 2025). Größere Praxen profitieren von mehr Ressourcen, was die Implementierung digitaler Technologien wie EHR und Telemedizin erleichtert, wie in Impact of Health Information Technology Optimization on Clinical Quality Performance in Health Centers und Digital Maturity and Its Determinants in General Practice beschrieben (Baillieu u. a. 2020; Teixeira u. a. 2022). Ressourcenknappheit und mangelnde digitale Infrastruktur, insbesondere in ländlichen oder unterversorgten Gebieten, hemmen die Digitalisierung, was durch eingeschränkten Internetzugang und geringere digitale Gesundheitskompetenz verstärkt wird, wie in Disparities in Digital Access Among American Rural and Urban Households und Geographic Variation in Ambulatory Electronic Health Record Adoption gezeigt (Curtis, Clingan, und Guo 2022; King, Furukawa, und Buntin 2013). Die Nutzung von Telemedizin und Patientenportalen ist in städtischen Praxen höher, wobei die COVID-19-Pandemie die Telemedizin-Nutzung zwar ankurbelte, ländliche Praxen jedoch zurückbleiben, wie in Before and During Pandemic Telemedicine Use und Video and Telephone Telehealth Use beschrieben (Larson, Zahnd, und Davis 2022; Rowe Ferrara, Intinarelli-Shuler, und Chapman 2025). Zusammenfassend besteht ein klarer Digitalisierungsrückstand in ländlichen Praxen, der durch strukturelle und ressourcenbedingte Barrieren verstärkt wird.
Auswirkungen der Digitalisierung & Digitale Trennung
Die Arbeit „Digitized patient–provider interaction: How does it matter? A qualitative meta-synthesis“ von Hege K. Andreassen und Kollegen untersucht die Digitalisierung der Patient-Ärzte-Interaktion durch eine meta-ethnografische Analyse von 15 qualitativen Studien. Sie identifiziert vier zentrale Konzepte – Respatialisierung, Wiederverbindung, Reaktion und Rekonfiguration –, die strukturelle Veränderungsprozesse in der Gesundheitsversorgung aufzeigen. Die Autoren argumentieren, dass digitale Interaktionen die räumlichen und sozialen Beziehungen verändern, neue Arbeitsprozesse schaffen und grundlegende gesellschaftliche Institutionen wie Arbeit und Krankheitsverständnis neu gestalten. Damit bietet die Studie einen soziologischen Rahmen, um die Bedeutung von E-Health über mikrosoziale Analysen hinaus zu verstehen und dessen Rolle im Wandel moderner Gesellschaften zu beleuchten. (Andreassen u. a. 2018)
Die Studie „Digital Divide – Soziale Unterschiede in der Nutzung digitaler Gesundheitsangebote“ von Alejandro Cornejo Müller, Benjamin Wachtler und Thomas Lampert untersucht, wie sich die Digitalisierung von Gesundheitsangeboten auf die gesundheitliche Chancengleichheit auswirkt. Durch eine Literaturübersicht zeigen die Autoren, dass die Nutzung digitaler Gesundheitsangebote stark mit soziodemografischen Faktoren wie Alter, Bildung und Einkommen sowie mit Gesundheitskompetenz zusammenhängt, wobei jüngere, höher gebildete und einkommensstärkere Personen diese häufiger in Anspruch nehmen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bestehende gesundheitliche Ungleichheiten durch den „Digital Divide“ – also Unterschiede in Zugang, Kompetenzen und Nutzung – verstärkt werden könnten, da sozial benachteiligte Gruppen weniger profitieren. Die Studie betont die Notwendigkeit weiterer Forschung, um die Auswirkungen sozialer Determinanten auf digitale Gesundheitsversorgung besser zu verstehen und gesundheitliche Ungleichheiten nicht zu verschärfen. (Cornejo Müller, Wachtler, und Lampert 2020)
Die Studie „Patients’ Experiences With Digitalization in the Health Care System: Qualitative Interview Study“ von Christian Gybel Jensen und Kollegen untersucht die digitalen Praktiken und Erfahrungen von Patienten im neurologischen Bereich mit öffentlichen digitalen Gesundheitsdiensten in Dänemark. Durch 31 halbstrukturierte Interviews zeigt die qualitative Analyse vier Hauptkategorien: soziale Ressourcen als digitale Lebensader, notwendige Fähigkeiten, starke Gefühle als Förderer oder Hindernisse und Leben ohne digitale Tools. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass der Zugang zu sozialer Unterstützung, physische, kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie Motivation und Komfort entscheidend sind, um digitale Tools positiv zu nutzen. Patienten ohne diese Voraussetzungen erleben Herausforderungen, fühlen sich ausgeschlossen und benachteiligt, was auf potenzielle Ungleichheiten im Gesundheitswesen hinweist. Die Autoren fordern eine Anpassung der Systeme an unterschiedliche digitale Gesundheitskompetenzen, um Inklusion zu fördern. (Gybel Jensen, Gybel Jensen, und Loft 2024)
Die Arbeit „The potential and paradoxes of eHealth research for digitally marginalised groups: A qualitative meta-review“ von Jessica A. Coetzer und Kollegen untersucht, wie die Forschung den Einsatz von eHealth bei digital marginalisierten Gruppen wie Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status, Migranten oder älteren Menschen betrachtet. Durch eine qualitative Meta-Analyse von 29 Studien identifizieren die Autoren vier Paradoxien: eHealth wird als einfache Lösung für komplexe Gesundheitsprobleme dargestellt; Barrieren werden individuell gerahmt, während Lösungen systemisch bleiben; Patienten und Gesundheitskräfte tragen die Hauptverantwortung trotz systemischer Ziele; und obwohl maßgeschneiderte Lösungen gefordert werden, werden Gruppen homogen betrachtet. Die Studie kritisiert diese Diskrepanzen und fordert einen Paradigmenwechsel hin zu systemischem Denken, um gesundheitliche Ungleichheiten nicht zu verschärfen. (Coetzer u. a. 2024)
Die wissenschaftliche Arbeit „Evaluating the Digital Health Experience for Patients in Primary Care: Mixed Methods Study“ von Melinda Ada Choy und Kollegen untersucht die Erfahrungen von Patienten mit digitaler Gesundheit in der Grundversorgung, mit einem Fokus auf den digitalen Gesundheitsunterschied bei sozioökonomisch benachteiligten Personen. Mithilfe eines explorativen Mixed-Methods-Designs wurden zunächst qualitative Interviews mit 19 Patienten geführt, die an chronischen Krankheiten und sozioökonomischen Nachteilen leiden, gefolgt von einer quantitativen Umfrage unter 487 Patienten aus australischen Allgemeinpraxen. Die Studie identifiziert sechs Haupthindernisse für den Zugang zu digitaler Gesundheit, darunter eine Präferenz für menschliche Dienstleistungen, geringes Vertrauen in digitale Angebote und hohe finanzielle Kosten. Die Ergebnisse zeigen, dass 31 % der Befragten noch nie digitale Gesundheitsdienste genutzt haben und dass häufige Nutzer höhere digitale Kompetenz und Interesse aufweisen. Die Autoren betonen, dass die Überwindung des digitalen Gesundheitsunterschieds maßgeschneiderte, mehrstufige Interventionen erfordert, die auf die individuellen Barrieren der Patienten abgestimmt sind. (Choy u. a. 2024)
Der Artikel „The Impact of Accelerated Digitization on Patient Portal Use by Underprivileged Racial Minority Groups During COVID-19: Longitudinal Study“ von Feng Mai und Kollegen untersucht, wie die beschleunigte Digitalisierung während der COVID-19-Pandemie die Nutzung von Patientenportalen durch benachteiligte rassische Minderheiten beeinflusst hat. Mit einem longitudinalen Datensatz eines großen städtischen akademischen medizinischen Zentrums in den USA analysierten die Autoren die Portalnutzung von 25.612 Patienten (20,13 % Schwarze, 0,99 % Hispanoamerikaner, 78,88 % Weiße) vor und während der Pandemie (März bis August 2019 und 2020). Die Studie zeigt, dass vor der Pandemie ein signifikanter digitaler Graben bestand, da Minderheitenpatienten das Portal weniger nutzten als weiße Patienten. Während der Pandemie verringerte sich dieser Graben jedoch, insbesondere durch die vermehrte Nutzung mobiler Geräte, wobei Minderheitenpatienten sowohl die Häufigkeit als auch die Vielfalt der Portalnutzung schneller steigerten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die beschleunigte Digitalisierung die digitale Kluft in der Telemedizin nicht verbreitert, sondern verkleinert hat, und bieten Ansätze für politische Maßnahmen zur weiteren Schließung dieses Grabens. (Mai u. a. 2023)
Der Artikel „Patients’ Experiences With Digitalization in the Health Care System: Qualitative Interview Study“ von Christian Gybel Jensen und Kollegen untersucht die digitalen Praktiken und Erfahrungen von Patienten mit öffentlichen digitalen Gesundheitsdiensten im neurologischen Bereich in Dänemark. Mithilfe eines qualitativen Designs mit hermeneutischem Ansatz wurden 31 semistrukturierte Interviews mit aktuell oder ehemals hospitalisierten Patienten eines neurologischen Krankenhausdepartments geführt. Die Analyse identifizierte vier Kategorien: soziale Ressourcen als digitale Lebensader, notwendige Fähigkeiten, starke Gefühle als Förderer oder Hindernisse und Leben ohne digitale Tools. Die Ergebnisse zeigen, dass der Zugang zu sozialer Unterstützung, physische, kognitive und kommunikative Fähigkeiten sowie Motivation und Komfort entscheidend für positive Erfahrungen mit digitalen Tools sind. Patienten ohne diese Voraussetzungen erlebten Herausforderungen und fühlten sich teilweise ausgeschlossen, was auf die Notwendigkeit hinweist, digitale Gesundheitsdienste flexibel und inklusiv zu gestalten, um gesundheitliche Ungleichheiten zu vermeiden. (Gybel Jensen, Gybel Jensen, und Loft 2024)
Sy Atezaz Saeed und Ross MacRae Masters beleuchten in „Disparities in Health Care and the Digital Divide“ die anhaltenden Ungleichheiten in Gesundheitsoutcomes und deren Verstärkung durch den digitalen Graben trotz neuer Technologien wie Telemedizin. Die Autoren zeigen, dass soziale Determinanten wie Armut, Geschlecht und Rasse die Nutzung von Gesundheitsinformationstechnologien (HIT) beeinflussen, wobei etwa Menschen mit niedrigem Einkommen, Frauen und Schwarze seltener Telemedizinbesuche abschließen. Während Technologien wie Telepsychiatrie die Versorgung bei Schizophrenie oder PTSD verbessern können, bleiben Herausforderungen wie unzureichender Internetzugang und geringe digitale Gesundheitskompetenz bestehen, insbesondere in ländlichen und einkommensschwachen Gebieten. Die Studie betont, dass HIT das Potenzial hat, die Versorgungsqualität zu steigern, jedoch gezielte Maßnahmen wie bessere IT-Unterstützung, Patientenaufklärung und Gleichheitsförderung erforderlich sind, um den digitalen Graben zu verringern und gerechte Gesundheitsoutcomes zu gewährleisten. (Saeed und Masters 2021)
Der Artikel „Telehealth and the Digital Divide: Identifying Potential Care Gaps in Video Visit Use“ untersucht die Barrieren für ältere Patienten bei der Nutzung von Videokonsultationen im Rahmen der Telemedizin. Während die COVID-19-Pandemie zu einem starken Anstieg virtueller Arztbesuche führte, bleibt der Zugang zu Videobesuchen ungleich verteilt, insbesondere für ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und wirtschaftlich Benachteiligte. Die Studie basiert auf Interviews mit Patienten und Klinikpersonal und zeigt, dass viele Patienten zwar über digitale Geräte verfügen, sich aber unsicher in deren Nutzung fühlen. Häufige Hindernisse sind mangelnde digitale Kompetenz, fehlende Unterstützung sowie technische Herausforderungen. Trotz eines allgemeinen Interesses an Videokonsultationen bevorzugen viele Patienten Telefonbesuche, da sie sich mit der Technologie überfordert fühlen. Das Klinikpersonal bestätigt diese Herausforderungen und betont die Notwendigkeit von Schulungen und technischer Unterstützung. Der Artikel unterstreicht, dass gezielte Maßnahmen erforderlich sind, um digitale Gesundheitslösungen inklusiver und zugänglicher zu gestalten. (Choxi u. a. 2022)
Die Übersichtsarbeit “Impact of COVID-19 on the digital divide: a rapid review” untersucht die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die “digitale Kluft” im Gesundheitswesen. Sie konzentriert sich darauf, wie bestehende Ungleichheiten beim digitalen Zugang und der Nutzung während der ersten Welle der Pandemie hervorgehoben wurden, als die Gesundheitsversorgung zunehmend auf digitale Technologien angewiesen war. Die Übersicht identifiziert Herausforderungen beim digitalen Zugang (wie Probleme mit der Internetverbindung), der digitalen Kompetenz (wo ethnische Minderheiten und ältere Menschen beim Zugang zur digitalen Gesundheitsversorgung auf Hindernisse stießen) und der digitalen Assimilation (die Integration digitaler Werkzeuge in den Alltag). Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Pandemie die anhaltende Natur der digitalen Kluft unterstrich, insbesondere in Bezug auf gefährdete Bevölkerungsgruppen wie ältere Menschen und ethnische Minderheiten, und betont die Notwendigkeit, diese Ungleichheiten anzugehen, da digitale Technologien im Gesundheitswesen immer wichtiger werden. (Litchfield, Shukla, und Greenfield 2021)
In “Health Disparities, Clinical Trials, and the Digital Divide” untersuchen die AutorInnen die Schnittstelle von gesundheitlichen Ungleichheiten, klinischen Studien und der digitalen Kluft, wobei die Notwendigkeit gerechter digitaler Gesundheitslösungen betont wird. Die Unterrepräsentation von ethnischen und rassischen Minderheiten in klinischen Studien wird hervorgehoben. Die Autoren erörtern, wie die digitale Kluft, gekennzeichnet durch ungleichen Zugang zu digitalen Technologien und Kompetenzen, gesundheitliche Ungleichheiten verschärft, was insbesondere während der COVID-19-Pandemie deutlich wurde. Sie schlagen Strategien vor, um digitale Gesundheitsgerechtigkeit in klinischen Studien zu erreichen, einschließlich gesellschaftlichem Engagement, nutzerzentriertem Design und der Berücksichtigung digitaler Determinanten der Gesundheit. Der Artikel liefert auch fachspezifische Beispiele in der Herz-Kreislauf-Medizin und der Dermatologie, die veranschaulichen, wie digitale Werkzeuge entweder Gesundheitsgerechtigkeitslücken überbrücken oder vergrößern können. Die Autoren schließen mit der Betonung der Bedeutung inklusiver digitaler Innovation und der Zusammenarbeit zwischen Bundesbehörden, Industrie und Wissenschaft, um gerechte Gesundheitsergebnisse zu gewährleisten. (Adedinsewo u. a. 2023)
Der Achte Altersbericht der Bundesregierung untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung auf ältere Menschen in den Bereichen Wohnen, Mobilität, soziale Integration, Gesundheit, Pflege und Sozialraum. Er betont, dass digitale Technologien das Potenzial haben, die Lebensqualität und Selbstständigkeit älterer Menschen zu fördern, etwa durch Smart Home-Systeme, Mobilitäts-Apps oder Telemedizin, jedoch bestehen Herausforderungen wie die digitale Spaltung, fehlende Kompetenzen und ethische Fragen. Die Kommission empfiehlt, den Zugang zu digitalen Technologien zu verbessern, digitale Souveränität zu stärken, generationsübergreifenden Austausch zu fördern und ethische Debatten anzustoßen. Zudem soll die Forschung zu den Wirkungen digitaler Technologien ausgebaut und die kommunale Daseinsvorsorge digital gestärkt werden, um Teilhabe und Autonomie zu sichern. (Berner, Endter, und Hagen 2020)
Die Studie „Inequities in Health Care Services Caused by the Adoption of Digital Health Technologies: Scoping Review“ untersucht die Ungleichheiten im Gesundheitswesen durch die Einführung digitaler Gesundheitstechnologien. Sie zeigt, dass diese Technologien, obwohl sie die Effizienz der Gesundheitsversorgung steigern sollen, zu Ungleichheiten führen, da nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen Zugang zu ihnen haben oder sie nutzen können. Faktoren wie Alter, Ethnie, Einkommen, Bildung, Gesundheitszustand und digitale Kompetenz beeinflussen diese Ungleichheiten. Die Studie schlägt Maßnahmen vor, um diese Ungleichheiten zu verringern, darunter staatliche Initiativen wie nationale Krankenversicherungen, die Entwicklung benutzerfreundlicher Technologien durch Anbieter und die Förderung digitaler Kompetenzen bei den Nutzern, um eine gerechtere Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. (Yao u. a. 2022)
Die Studie „Understanding factors influencing the adoption of mHealth by the elderly: An extension of the UTAUT model“ untersucht die Faktoren, die die Akzeptanz von mobilen Gesundheitsdiensten (mHealth) bei älteren Menschen in Entwicklungsländern wie Bangladesch beeinflussen. Basierend auf dem Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) zeigt die Untersuchung, dass Leistungserwartung, Aufwandserwartung, sozialer Einfluss, Technologieangst und Widerstand gegen Veränderungen die Nutzungsabsicht älterer Menschen signifikant beeinflussen. Hingegen hat die unterstützende Infrastruktur keinen signifikanten Einfluss auf die Nutzungsabsicht. Die Ergebnisse bieten wertvolle Einblicke für mHealth-Anbieter und Entscheidungsträger, um die Einführung und Gestaltung von mHealth-Diensten zu verbessern, und bestätigen die Anwendbarkeit des UTAUT-Modells in diesem Kontext. (Hoque und Sorwar 2017)
Der Artikel „Unlocking Digital Health: Inequalities in the adoption of a Patient Portal“ untersucht Ungleichheiten bei der Nutzung des Patientenportals MyChart in zwei großen Londoner NHS-Krankenhäusern. Die Studie zeigt, dass insbesondere Männer, Menschen am Lebensanfang und -ende, Angehörige bestimmter Ethnien sowie Personen aus sozioökonomisch benachteiligten Gebieten das Portal weniger aktivieren. Diese Unterschiede bleiben auch nach Berücksichtigung anderer Faktoren bestehen und lassen sich nicht allein durch den Zugang zu E-Mail oder Telefon erklären. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass digitale Gesundheitsangebote ohne gezielte Maßnahmen bestehende Ungleichheiten verstärken können und eine gezielte Förderung notwendig ist, um einen gleichberechtigten Zugang sicherzustellen. (Barker u. a. 2025)
Die Arbeiten befassen sich mit dem Thema der digitalen Kluft und deren sozialen Implikationen. In „Social capital and the three levels of digital divide“ von Massimo Ragnedda und Maria Laura Ruiu wird die Wechselwirkung zwischen sozialem und digitalem Kapital untersucht, wobei die multidimensionalen Aspekte sozialer Ungleichheiten und deren Einfluss auf digitale Ungleichheiten analysiert werden. „The Third-Level Digital Divide: Who Benefits Most from Being Online?“ von Alexander J. A. M. van Deursen und Ellen J. Helsper untersucht, wie Menschen mit höherem sozialen Status stärkere Vorteile aus der Internetnutzung ziehen, was bestehende soziale Ungleichheiten verstärken kann. „New insights from a multilevel approach to the regional digital divide in the European Union“ von Monica Răileanu Szeles analysiert regionale und nationale Determinanten der digitalen Kluft in der EU und schlägt gemischte politische Maßnahmen zur Reduzierung regionaler digitaler Ungleichheiten vor. „The Third Digital Divide: A Weberian Approach to Digital Inequalities“ von Massimo Ragnedda verwendet Max Webers Theorie der Schichtung, um digitale Ungleichheiten zu untersuchen, und betont, dass diese über wirtschaftliche Aspekte hinausgehen und kulturelle sowie politische Dimensionen umfassen. (Ragnedda und Ruiu 2017; Szeles 2018; Ragnedda 2017; Van Deursen und Helsper 2015)
Die Studie mit dem Titel „Video-based telemedicine utilization patterns and associated factors among racial and ethnic minorities in the United States during the COVID-19 pandemic“ untersucht die Nutzung von videobasierten Telemedizin-Diensten unter verschiedenen ethnischen Minderheiten in den USA während der COVID-19-Pandemie. Die Arbeit basiert auf einer umfassenden Analyse von 77 Studien aus den Jahren 2020 bis 2023. Die Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung von Telemedizin bei schwarzen und hispanischen Bevölkerungsgruppen häufiger zunahm, während asiatische, indianische und pazifische Minderheitengruppen eine gemischte oder verringerte Nutzung aufwiesen. Untersucht wurden auch Hindernisse wie mangelnder Zugang zu digitalen Technologien, unzureichende Infrastruktur, Vorurteile von Anbietern und sozioökonomische Faktoren sowie fördernde Elemente wie Vertrauen, kulturelle Anpassungen und politische Unterstützung. Die Studie hebt die Notwendigkeit gezielter Maßnahmen hervor, um digitale Gesundheitsversorgung für ethnische Minderheiten gerechter und zugänglicher zu gestalten. (Meddar u. a. 2025)
Digitale Trennung überwinden
Das Projekt „Digital im Alter – Di@-Lotsen“ soll älteren Menschen den Zugang zur digitalen Welt erleichtern. Ehrenamtliche Di@-Lotsinnen und -Lotsen bieten niedrigschwellige, wohnortnahe Unterstützung, etwa durch Kurse oder Hausbesuche, um digitale Kompetenzen zu vermitteln. Lokale Stützpunkte koordinieren diese Angebote, stellen Technik wie Tablets bereit und fördern die Vernetzung. Das Projekt, gestartet im Juli 2021, umfasst mittlerweile über 60 Stützpunkte und 500 Lotsen, die den Alltag älterer Menschen durch digitale Teilhabe bereichern.
Die Studie „Implementing a Digital Health Navigator: Strategies and Experience in the Hospital Setting to Alleviate Digital Equity“ von Saiyed et al. beschreibt die Einführung eines Digital Health Navigator (DHN)-Programms an der Universitätsklinik Pittsburgh. Ziel war es, die Nutzung digitaler Gesundheitstools, insbesondere des Patientenportals, zu fördern und digitale Ungleichheiten zu verringern. Über 30 Tage hinweg unterstützte das DHN-Programm 260 Patienten in zwei Krankenhäusern durch persönliche Schulungen, was zu einer hohen Akzeptanz (98 % fanden die Schulung hilfreich) und Zufriedenheit (90 % würden das Portal weiterempfehlen) führte. Besonders ältere Patienten und solche mit begrenztem Technologiezugang profitierten. (Saiyed u. a. 2024)
Die Studie „The Los Angeles County Department of Health Services Health Technology Navigators“ von Casillas und Abhat beschreibt die Einführung eines Health Technology Navigator (HTN)-Programms im Los Angeles County Department of Health Services (LAC DHS). Das Programm zielt darauf ab, digitale Ungleichheiten zu überwinden, indem es Patienten, insbesondere aus unterversorgten Gruppen, durch persönliche Unterstützung bei der Nutzung des Patientenportals befähigt. Seit November 2021 haben 13 Navigatoren die Portalregistrierung von 20 % auf 42 % der aktiven Patienten gesteigert, mit über 30.000 dokumentierten Einschreibungen bis Juni 2023. Das Programm verbessert die digitale Gesundheitskompetenz, erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit und wird als Modell für andere Gesundheitssysteme vorgeschlagen, um gerechtere Zugänge zu digitaler Gesundheitsversorgung zu schaffen. (Casillas und Abhat 2024)
Die Rolle von Digitalen Navigatoren bei der Implementierung von Smartphone- und Digitaltechnologien in der psychiatrischen Versorgung
Die Studie „Digital Navigators to Implement Smartphone and Digital Tools in Care“ von Wisniewski und Torous (2020) beschreibt die Einführung von Digitalen Navigatoren als neue Mitglieder des Behandlungsteams, um die Implementierung digitaler Gesundheitstools, insbesondere Smartphone-Apps, in der psychiatrischen Versorgung zu fördern. Diese Navigatoren unterstützen bei der Auswahl sicherer und effektiver Apps, bieten technische Unterstützung außerhalb von Klinikbesuchen und fassen App-Daten zusammen, um klinische Entscheidungen zu erleichtern. Trotz des Potenzials digitaler Tools bleiben deren Einsatz in der Praxis begrenzt, unter anderem aufgrund von Herausforderungen wie mangelnder Akzeptanz durch Klinikpersonal, Schwierigkeiten bei der Integration in elektronische Patientenakten und geringer Benutzerfreundlichkeit. Digitale Navigatoren adressieren diese Barrieren durch evidenzbasierte App-Bewertung, technische Unterstützung und datengestützte Vorbereitung von Patientenbesuchen, wodurch die therapeutische Allianz gestärkt und die Versorgung verbessert wird. (Wisniewski und Torous 2020)
„Translating Digital Health into the Real World: The Evolving Role of Digital Navigators to Enhance Mental Health Access and Outcomes“ ist ein im Oktober 2025 veröffentlichter Kommentar in der Zeitschrift Journal of Technology in Behavioral Science. Der Beitrag beschreibt die wachsende Lücke zwischen Bedarf und Verfügbarkeit von Verhaltenstherapieangeboten sowie die begrenzte Wirksamkeit digitaler Psychotherapie-Tools aufgrund geringer Nutzerbindung, mangelnder klinischer Integration und des digitalen Grabens. Als Lösungsansatz wird die Einführung sogenannter Digital Navigators (DNs) vorgeschlagen – speziell geschulte Fachkräfte, die Patienten und Behandler bei der Auswahl, Einführung und dauerhaften Nutzung evidenzbasierter Mental-Health-Apps unterstützen, digitale Kompetenzen fördern und so den Zugang zu sowie die Wirksamkeit digitaler Versorgungsangebote verbessern sollen.
„Building Mutually Beneficial Collaborations Between Digital Navigators, Mental Health Professionals, and Clients: Naturalistic Observational Case Study“ ist eine im November 2024 in JMIR Mental Health erschienene Fallstudie. Die Autoren berichten über die reale Implementierung einer Digital-Navigator-Rolle in einer multidisziplinären psychotherapeutischen Praxis in Sydney. Ziel war es, die Nutzung der messbasierten digitalen Plattform Innowell durch Klienten und Fachkräfte zu verbessern. Die Beobachtungen zeigen, dass eine erfolgreiche Integration nur durch enge, wechselseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zwischen Digital Navigator, Behandelnden und Klienten gelingt. Der Digital Navigator unterstützt vor allem durch technische Hilfe, Zielklärung und Förderung gemeinsamer Entscheidungen, während isolierte Unterstützung ohne Einbindung der Behandelnden meist nur kurzfristig wirkt.
Nebenwirkungen digitaler Technologien
Die Arbeit “Power, paradox and pessimism: On the unintended consequences of digital health technologies in primary care” von Sue Ziebland, Emma Hyde und John Powell untersucht die unbeabsichtigten Folgen des Einsatzes digitaler Gesundheitstechnologien in der Primärversorgung. Die Autoren führen eine konzeptionelle Literaturübersicht durch, um ein tieferes Verständnis der komplexen Auswirkungen dieser Technologien – wie Online-Konsultationen, elektronische Patientenakten und Apps – auf Menschen, Beziehungen und Arbeitsweisen zu gewinnen. Sie identifizieren drei zentrale Themen: die Änderung von Machtverhältnissen zwischen Patienten und Fachkräften, paradoxe Ergebnisse, die den ursprünglichen Absichten widersprechen, und eine wachsende Pessimismus-Kultur unter Mitarbeitern gegenüber digitalen Innovationen. Die Studie betont die Notwendigkeit, bei der Planung solcher Technologien die potenziellen negativen Effekte zu berücksichtigen, insbesondere vor dem Hintergrund der durch die Covid-19-Pandemie beschleunigten Digitalisierung. Ziel ist es, zukünftige Implementierungen durch ein besseres Verständnis dieser Dynamiken zu verbessern und eine reflektierende Lernkultur zu fördern. (Ziebland, Hyde, und Powell 2021)
Die Studie „Meaningless work: How the datafication of health reconfigures knowledge about work and erodes professional judgement“ von Klaus Hoeyer und Sarah Wadmann untersucht, wie die Datifizierung im stark digitalisierten dänischen Gesundheitssektor die Wahrnehmung von Arbeit und professionelles Urteilsvermögen verändert. Basierend auf Interviews und Beobachtungen zeigen die Autoren, dass die zunehmende Datenintensität – gerechtfertigt durch Ziele wie Effizienz und Evidenzbasierung – zu Kontrolle und Überwachung führt, aber auch „sinnlose Arbeit“ erzeugt, die von Leistungserbringern als „kafkaeske Situation“ empfunden wird. Sie identifizieren Dynamiken, die dieses Empfinden antreiben, etwa standardisierte Datenanforderungen, die klinische Ziele verfehlen, und argumentieren, dass Daten oft symbolische Kommunikation statt praktischen Nutzen dienen. Die Studie hebt drei Folgen hervor: Ressourcenverschiebung von Patientenversorgung zu Datenarbeit, epistemische Zweifel an Datenvalidität und eine veränderte Arbeitskultur, die klinische Prioritäten verschiebt. Sie fordert, Raum für Urteilsvermögen in datengesättigten Systemen zu bewahren, um sinnvolle Arbeit zu fördern. (Hoeyer und Wadmann 2020)
Die Studie „The double-edged sword of digital self-care: Physician perspectives from Northern Germany“ von Amelia Fiske, Alena Buyx und Barbara Prainsack untersucht, wie Ärzte in Norddeutschland digitale Selbstfürsorge-Praktiken wahrnehmen und in ihre Arbeit integrieren. Basierend auf 15 Interviews aus dem Jahr 2018 zeigt die Untersuchung, dass Ärzte digitale Selbstfürsorge – wie die Nutzung von Smartphones zur Datenerfassung oder Online-Diagnosetests – ambivalent beurteilen: Sie sehen Potenzial für mehr Patientenautonomie und verbesserte Versorgung, äußern jedoch Bedenken hinsichtlich Validität, Fehldiagnosen und zusätzlicher Belastungen für das Gesundheitssystem. Die Ergebnisse verdeutlichen eine Diskrepanz zwischen technikoptimistischen Narrativen über „e-Patienten“ und den tatsächlichen Erfahrungen der Ärzte, die persönliche Beziehungen und ärztliche Anleitung als essenziell für eine sichere Nutzung betonen. Digitale Selbstfürsorge wird als „doppelseitiges Schwert“ beschrieben, das Empowerment bietet, aber nicht die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung ersetzen kann, und regulatorische sowie ethische Herausforderungen aufwirft. (Fiske, Buyx, und Prainsack 2020)
Die Arbeit „eHealth in primary care. Part 2: Exploring the ethical implications of its application in primary care practice“ von Sarah N. Boers und Kollegen untersucht die ethischen Implikationen von eHealth in der Primärversorgung. Sie argumentiert, dass eHealth – wie Gesundheits-Apps, Wearables und Entscheidungsunterstützungssysteme – Selbstmanagement und personalisierte Medizin fördert, jedoch auch ethische Herausforderungen birgt. Die Autoren analysieren vier zentrale Aspekte: (1) den Umgang mit diagnostischer Unsicherheit durch nicht-erklärbare Algorithmen, die Verantwortung, Gerechtigkeit und Autonomie beeinflussen; (2) veränderte Patientenrollen, bei denen Autonomie gefördert, aber auch durch Technologien eingeschränkt werden kann; (3) neue Verantwortlichkeiten und Verantwortungslücken durch Technologie-Delegation; (4) die trianguläre Beziehung Patient–eHealth–Arzt, die menschliche Interaktion und gemeinsame Entscheidungsfindung neu gestaltet. Die Studie fordert eine parallele ethische Forschung, um praxisgerechte Richtlinien zu entwickeln, und betont die Notwendigkeit, diese Implikationen bei der Implementierung von eHealth zu berücksichtigen. (Boers u. a. 2020)
Die Studie „Unintended consequences of online consultations: a qualitative study in UK primary care“ von Andrew Turner und Kollegen untersucht die unbeabsichtigten Folgen von Online-Konsultationen in der britischen Primärversorgung. Basierend auf Interviews mit 19 Patienten und 18 Mitarbeitern aus acht Praxen in Südwest- und Nordwestengland zwischen Februar 2019 und Januar 2020 zeigt die Studie, dass Online-Tools, die den Zugang zu Pflege verbessern und Effizienz steigern sollen, unerwartete Probleme verursachen. Dazu gehören eingeschränkter Zugang für digital ausgeschlossene Patienten, Schwierigkeiten bei der effektiven Kommunikation mit Ärzten sowie zusätzliche Arbeitsbelastung und Isolation für das Personal. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass diese Folgen oft aus Unsicherheiten über Prozesse und der Bevorzugung simpler, transaktionaler Interaktionen resultieren, was die ganzheitliche Betreuung beeinträchtigt. Die Autoren betonen die Notwendigkeit, diese Herausforderungen zu erkennen und durch maßgeschneiderte Prozesse zu mildern, um die Vorteile der Technologie zu nutzen. (Turner u. a. 2021)
Digitale Trennung auf Seite der Leistungsbringer
Studien wie „Primary Care Physician Gender and Electronic Health Record Workload“ und „Gender Differences in Time Spent on Documentation and the Electronic Health Record in a Large Ambulatory Network“ beobachten, dass weibliche Ärztinnen mehr Zeit mit elektronischen Gesundheitsakten (EHR), Posteingangsnachrichten und Patientenkommunikation verbringen (Rittenberg, Liebman, und Rexrode 2022; Rotenstein u. a. 2022; Branford u. a. 2025; Malacon u. a. 2024).
Ländlichkeit
Verschiedene Studien untersuchen das gemeinsame Thema der Disparitäten in der Nutzung digitaler Technologien zwischen ländlichen und städtischen Gebieten im US-Gesundheitswesen. Die Studie „The Use of Information Technologies Among Rural and Urban Physicians in Florida“ (Menachemi et al., 2007) analysiert speziell die Adoption von IT-Anwendungen wie EHR, E-Mail mit Patienten und PDAs bei ambulanten Ärzten in Florida und zeigt, dass ländliche Ärzte seltener EHR (17,6 % vs. 24,1 %) und Patienten-E-Mail nutzen, wobei Unterschiede durch Praxisgröße und -typ erklärbar sind, während Barrieren wie Produktivitätsverluste stärker in ländlichen Regionen hervortreten. Die Studie „Disparities in digital access among American rural and urban households and implications for telemedicine-based services“ (Curtis et al., 2021) beleuchtet auf Haushaltsebene den Zugang zu Hochgeschwindigkeitsinternet und Geräten, wobei nicht-metropolitane Haushalte signifikant häufiger keinen digitalen Zugang haben (23,42 % vs. 13,03 %), was Auswirkungen auf Telemedizin hat und durch Faktoren wie Rasse/Ethnizität und Einkommen verstärkt wird. Die Studie „Lower electronic health record adoption and interoperability in rural versus urban physician participants: a cross-sectional analysis from the CMS quality payment program“ (Anzalone et al., 2025) fokussiert auf EHR-Adoption und Interoperabilität im CMS-Programm 2021, mit niedrigeren Raten bei ländlichen Ärzten (64 % vs. 74 %) und geringeren Promoting-Interoperability-Scores, beeinflusst durch Härtefälle, kleine Praxen und Mangelgebiete.
Der Artikel „Bridging Rural America’s Digital Divide in Health Care“ von Sara Novak, veröffentlicht am 9. Dezember 2025 im Journal of Medical Internet Research, beleuchtet die digitale Kluft im Gesundheitswesen ländlicher Regionen der USA. Er identifiziert drei zentrale Säulen des digitalen Zugangs – Infrastruktur, Bezahlbarkeit und Adoption – als entscheidend für den Zugang zu Telemedizin und digitalen Gesundheitsdiensten. Der Text beschreibt Ansätze wie Partnerschaften mit Telekommunikationsunternehmen und Stromversorgern zur Breitbandversorgung, kreative Lösungen aus dem Bildungssektor (z. B. WLAN-Hotspots oder mobile Einheiten) sowie Unterstützungsprogramme durch Digital Navigatoren und mobilbasierte Therapie-Apps, um Barrieren abzubauen und den Zugang zu Gesundheitsversorgung zu verbessern.
Der Artikel „Health promotion and the digital determinants of health“ von Louise Holly, Soe Yu Naing, Hannah Pitt, Samantha Thomas und Ilona Kickbusch, veröffentlicht in Health Promotion International (Volume 40, Issue 2, April 2025), ist das Editorial eines Special Issues zu den digitalen Determinanten der Gesundheit. Er beschreibt die Entwicklung des Konzepts der digitalen Determinanten von Gesundheit (DDoH), betont deren Interaktion mit sozialen, kommerziellen und politischen Determinanten und hebt sowohl positive Potenziale als auch Risiken digitaler Technologien hervor. Das Editorial fordert die Gesundheitsförderung auf, eine führende Rolle bei der Gestaltung gesunder digitaler Umgebungen einzunehmen, Ungleichheiten zu bekämpfen und evidenzbasierte Maßnahmen zu entwickeln, um gesundheitliche Chancen zu maximieren und Schäden zu minimieren.
„A framework for digital health equity“ ist ein 2022 in npj Digital Medicine veröffentlichter Review-Artikel von Safiya Richardson, Katharine Lawrence und Devin Mann. Der Beitrag stellt ein erweitertes Rahmenwerk vor, das die bestehende NIMHD-Research-Framework um eine eigene Domäne „digital environment“ ergänzt und darin zentrale digitale Determinanten der Gesundheit (Digital Determinants of Health, DDoH) systematisiert. Das Framework beschreibt auf individueller, zwischenmenschlicher, gemeinschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene Faktoren wie digital literacy, Technologiezugang, Breitbandinfrastruktur, implizite Technologie-Voreingenommenheit, algorithmische Bias und Technologiepolitik, die den Zugang zu und die Ergebnisse von digitaler Gesundheitsversorgung maßgeblich beeinflussen. Ziel ist es, Entwickler, Gesundheitssysteme und Forschung dabei zu unterstützen, gesundheitliche Ungleichheiten durch die zunehmende Digitalisierung nicht zu verstärken, sondern gezielt abzubauen.
„Cocreating Principles for Digital Health Equity: Cross-Sectional, Qualitative Study for Participatory Human-Centered Design in Catalonia“ ist eine im Januar 2026 im Journal of Medical Internet Research veröffentlichte Studie. Sie beschreibt einen groß angelegten partizipativen Human-Centered-Design-Prozess in Katalonien, an dem 265 Teilnehmende aus vier Stakeholder-Gruppen (Bürgerinnen und Angehörige, Gesundheitsfachkräfte, Führungskräfte sowie Digital-Health-Expertinnen) beteiligt waren. In zwei aufeinanderfolgenden Phasen zwischen Juni 2024 und April 2025 wurden durch Design-Thinking-Methoden und visuelle Co-Creation-Tools die zentralen Barrieren digitaler Gesundheitsungleichheit identifiziert und zehn grundlegende Gestaltungsprinzipien für eine gerechte digitale Gesundheitstransformation gemeinsam erarbeitet. Die Ergebnisse bieten einen konkreten Rahmen für die Entwicklung inklusiver, nutzerzentrierter und vertrauenswürdiger Gesundheitsinformationssysteme im Rahmen der katalanischen Digital Health Strategy 2026–2031.
Weiteres
Die Studie „Digitale Teilhabe 2025“ (Bitkom-Studie 2025) untersucht auf Basis einer repräsentativen Befragung von 1.003 Personen ab 16 Jahren in Deutschland die digitale Teilhabe und die wahrgenommene digitale Spaltung der Gesellschaft. Sie zeigt deutliche Unterschiede vor allem zwischen Altersgruppen: Während nahezu alle unter 65 Jahren das Internet nutzen, sinkt die Nutzungsquote bei den 65- bis 74-Jährigen auf 88 % und bei den über 75-Jährigen auf 54 %. Die Digitalisierung wird von 88 % der Befragten überwiegend als Chance gesehen, dennoch empfinden 67 % eine digitale Spaltung der Gesellschaft. Besonders ältere Menschen berichten häufiger von Überforderung, technischen Hürden, Datenschutzbedenken und geringerer Offenheit gegenüber neuen Technologien. Gleichzeitig erleichtern digitale Anwendungen für 79 % den Alltag, und 72 % wünschen sich mehr digitale Angebote. Die Studie beleuchtet zudem niedrige Selbsteinschätzungen der Medienkompetenz (insbesondere bei Älteren), Unsicherheiten beim Erkennen von Falschinformationen sowie ambivalente Haltungen zu Künstlicher Intelligenz und sozialen Medien im Kontext demokratischer Prozesse.
Der Text erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit und stellt keine Rechtsberatung dar. Anmerkungen können in der rechten Seitenleiste mit Hypothes.is sozialem Annotierungswerkzeug oder am unteren Ende einer Seite mit GitHub Giscus Diskussionen hinterlassen werden.